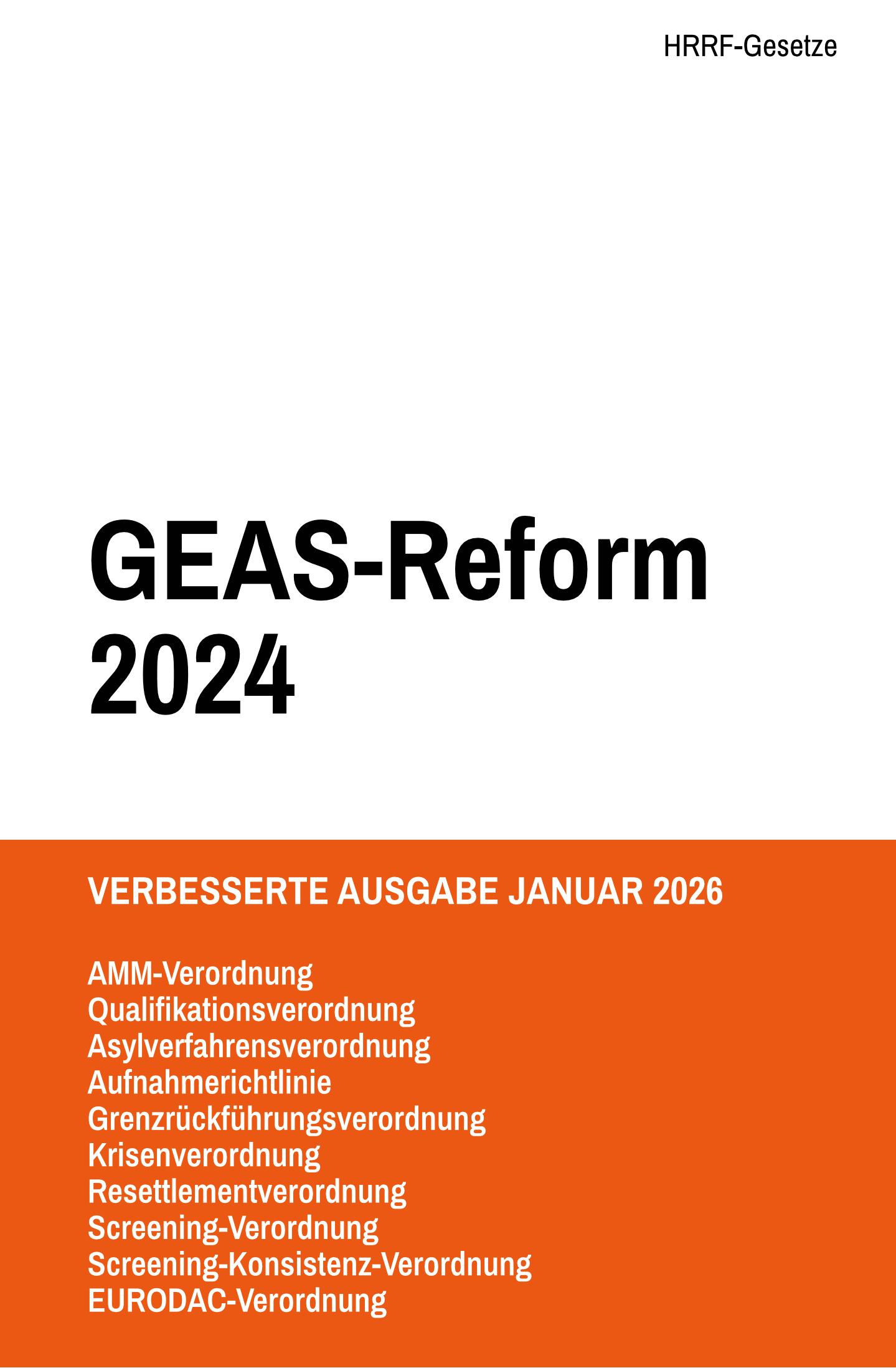In der Entscheidung der Woche hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass der deutsche Familienflüchtlingsschutz eine günstigere Norm im Sinne der EU-Qualifikationsrichtlinie darstellt und mit EU-Recht vereinbar ist. Außerdem geht es in dieser Ausgabe um zeitliche Höchstgrenzen und Fluchtgefahr bei Dublin-Verfahren, um Gehörsrügen, Beschäftigungsduldungen, Prozesskostenhilfe bei Ausweisungsentscheidungen sowie um elektronische Aktenführung beim BAMF.
Ausgabe
•
Günstigere Normen
Die Kommentarfunktion findet sich bei den einzelnen Beiträgen: Einfach auf die Überschrift klicken, um zum jeweiligen Beitrag zu gelangen.
Neu im Blog
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026
Indiz- und Bindungswirkung vorläufiger Maßnahmen des UN-Sozialauschusses?
20. Januar 2026
Im Oktober 2025 hat der UN-Sozialausschuss in einer Eilentscheidung entschieden, dass Deutschland einer vom Leistungsausschluss in Dublin-Fällen betroffenen Person existenzsichernde Leistungen gewähren muss. Dieser Beitrag analysiert die Entscheidung und beantwortet die Frage, ob ihr eine Indiz- und Bindungswirkung zukommt …
Dublin und die Drittstaaten
1. Januar 2026