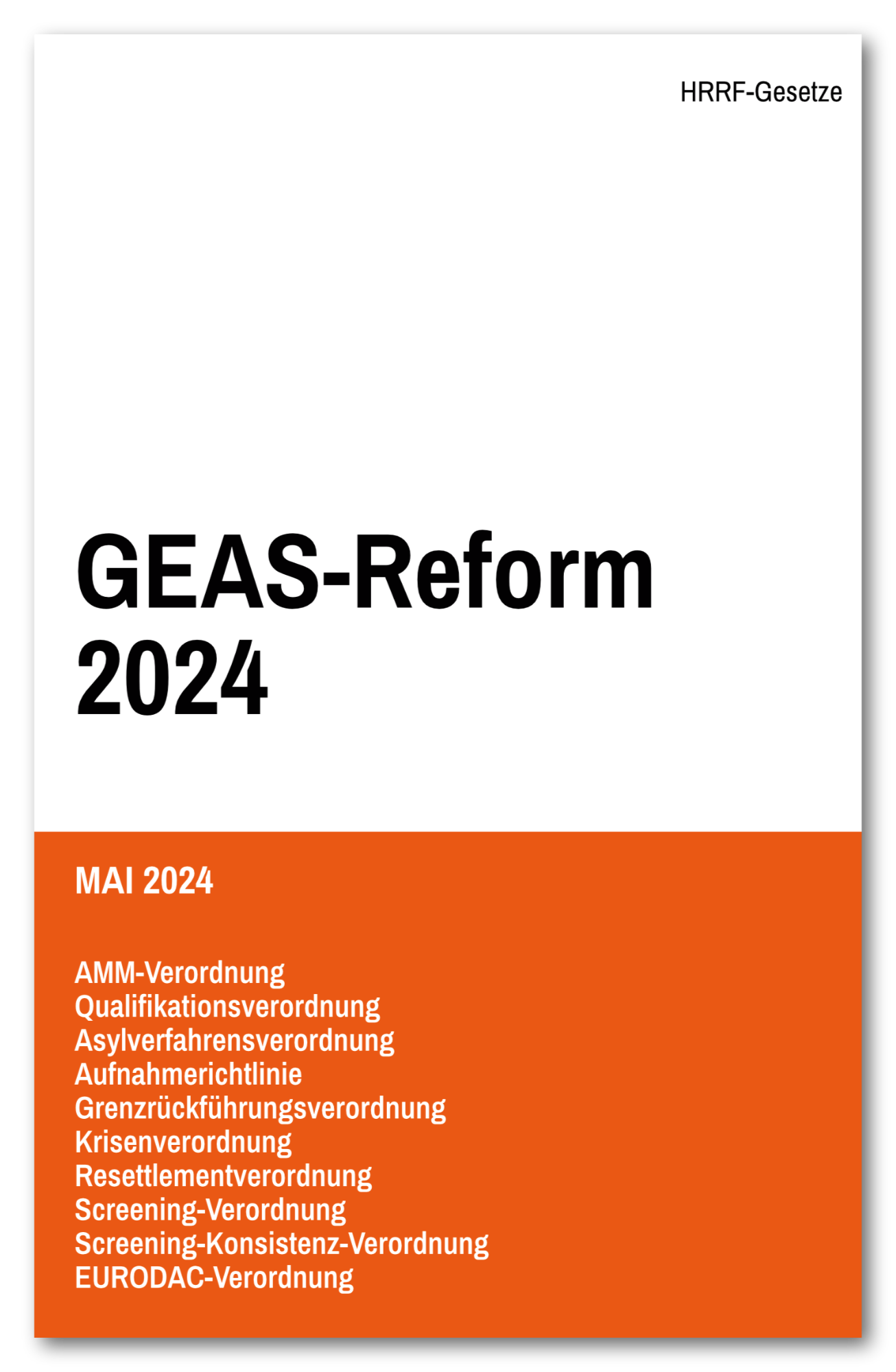Unauffälliges Leben
Verwaltungsgericht Frankfurt/Main steht zu Diskretionsgebot
Laut zahlreichen Medienberichten (taz, taz, Frankfurter Rundschau, hessenschau, FAZ, LSVD, beck-aktuell) hat das Verwaltungsgericht Frankfurt/Main in einem Urteil vom 16. August 2022 (Az. 3 K 469/21.F.A) die Klage eines homosexuellen Algeriers gegen die Ablehnung seines Asylfolgeantrags unter anderem mit der Erwägung abgelehnt, der Kläger solle seine Homosexualität in Algerien nicht ausleben, sondern ein „unauffälliges Leben“ führen. Selbst die Pressemitteilung des Gerichts stellt darauf ab, dass der Kläger zwar „Umarmen, Küssen, Händchenhalten in der Öffentlichkeit“ vermisse, dass dies aber in Algerien auch unter heterosexuellen Paaren unüblich und verpönt sei. Das erinnert an die Argumentation des Gerichts in einem früheren Verfahren (Urteil vom 5. März 2020, Az. 3 K 2341/19.F.A), gegen das der Verwaltungsgerichtshof Kassel die Berufung in seinem Beschluss vom 4. November 2020 (Az. 4 A 1215/20.Z.A) nicht zugelassen hatte. Einmal abgesehen davon, dass die Rechtsauffassung des Gerichts entgegen der Ausführungen in seiner Pressemitteilung sehr wohl in Widerspruch zur einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 7. November 2013, Rs. C-199/12 u.a.) stehen dürfte, fehlt hier doch auch jede Bezugnahme auf eine drohende nichtstaatliche Verfolgung Homosexueller in Algerien, die etwa vor nicht allzu langer Zeit das Verwaltungsgericht Würzburg (Urteil vom 15. Juni 2020, Az. W 8 K 20.30255) oder das Verwaltungsgericht Karlsruhe (Urteil v. 14. August 2018, Az. A 1 K 6549/16) bejaht hatten.
Verfolgung homosexueller Männer in Gambia
Männern, deren Homosexualität bedeutsamer Bestandteil ihrer sexuellen Identität sei, drohe gegenwärtig in Gambia mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit landesweit eine Verfolgung in Form einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, die so gravierend sei, dass sie in der Gesamtschau einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung gleichkomme, so der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in seinem Urteil vom 6. Juli 2022 (Az. A 13 S 733/21). Insbesondere hätten homosexuelle Männer in Gambia nicht die Möglichkeit, internen Schutz gemäß § 3e AsylG vor Verfolgung wegen ihrer sexuellen Identität zu erhalten, und dürften sie nicht darauf verwiesen werden, dass sie sich durch das Verheimlichen ihrer sexuellen Identität der ansonsten beachtlich wahrscheinlichen Verfolgung entziehen könnten.
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wegen Konversion
Mit Urteil vom 14. Juli 2022 (Az. 3 L 9/20) hat das Oberverwaltungsgericht Magdeburg das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verpflichtet, die aus dem Iran geflohenen und zum Christentum konvertierten Kläger als Flüchtlinge anzuerkennen. Bei zum Christentum konvertierten iranischen Staatsangehörigen, so das Gericht, bestehe im Falle einer Rückkehr in den Iran eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit, wenn der Glaubenswechsel auf einer ernsthaften und ihre religiöse Identität bindend prägenden Hinwendung zur christlichen Religion beruhe, so dass davon auszugehen sei, dass der Betreffende auch im Iran entsprechend seinen Glaubensvorstellungen leben bzw. allein unter dem Druck der Verfolgungsgefahr auf die Glaubensbetätigung verzichten werde. So weit, so gut, aber in der Praxis geht es ja immer maßgeblich auch um die Glaubwürdigkeit einer Konversion, jedenfalls aus Sicht des Gerichts. Das hat im entschiedenen Verfahren geklappt: Die Kläger hätten in der persönlichen Anhörung durch das Gericht in der mündlichen Verhandlung einen nachvollziehbaren inneren Prozess der Auseinandersetzung mit ihren Glaubensvorstellungen und der schlussendlichen nachhaltigen Hinwendung zur christlichen Glaubenslehre dargelegt.
Zumutbarkeit einer auf einen Elternteil bezogenen aufenthaltsbeendenden Maßnahme
Mit Beschluss vom 6. Juli 2022 (Az. 11 S 2378/21) hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim entschieden, dass bei der Würdigung der Zumutbarkeit einer auf einen Elternteil bezogenen aufenthaltsbeendenden Maßnahme für die Beziehung zwischen Eltern und Kind von erheblicher Bedeutung ist, ob es dem Kind und dem anderen Elternteil möglich ist und zugemutet werden kann, den von der Maßnahme betroffenen Ausländer ins Ausland zu begleiten oder ihm zeitnah dorthin zu folgen. Für die Prüfung der Zumutbarkeit schlägt der VGH eine vierfache Je-Umso-Prüfung vor: Eine aufenthaltsbeendende Maßnahme ist umso eher zumutbar, (1.) je weniger der Aufenthalt des Kindes und des anderen Elternteils im Bundesgebiet gesichert sei und (2.) je weiter die Möglichkeiten der Familie gefächert seien, ihre schutzwürdige Gemeinschaft nach der Ausreise aus dem Bundesgebiet an einem anderen Ort unvermindert fortzuführen. Umgekehrt werde die Zumutbarkeit einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme mit Blick auf Art. 6 Abs. 1 und 2 GG umso eher zu verneinen sein, (3.) je stärker der Aufenthalt des Kindes und des anderen Elternteils im Bundesgebiet gesichert sei und (4.) je weniger davon ausgegangen werden könne, dass es der Familie nach der Durchführung der Maßnahme möglich und zumutbar wäre, ihre schutzwürdige Gemeinschaft im Ausland unvermindert fortzuführen.
Feststellung rechtswidriger Haft unabhängig von Haftbeschwerde
In seinem Beschluss vom 25. April 2022 (Az. XIII ZB 19/21) hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass über einen mit einem Feststellungsantrag verbundenen Haftaufhebungsantrag gemäß § 426 Abs. 2 S. 1 FamFG auch dann noch entschieden werden muss, wenn das Gericht bereits über eine parallel eingelegte Haftbeschwerde entschieden hat. Bei dem Verfahren gemäß § 426 Abs. 2 S. 1 FamFG handele es sich um ein eigenständiges Verfahren, das unabhängig von der Einlegung oder Durchführung einer Beschwerde sei. Das ist im Prinzip keine neue Erkenntnis.
Aufenthalt in ungarischer Transitzone immer noch Inhaftierung
Mit Urteil vom 25. August 2022 (Az. 36896/18, W.O. u.a. gg. Ungarn) hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erneut entschieden, dass ein mehrmonatiger Aufenthalt in der Transitzone in Röszke, Ungarn, de facto einer Freiheitsentziehung gleichkommt und gegen Art. 5 EMRK verstößt. Außerdem hat der EGMR wegen der Aufenthaltsbedingungen in der Transitzone auch einen Verstoß gegen Art. 3 EMRK festgestellt. Das Urteil ist eine Fortführung der Rechtsprechung des EGMR zu Transitzonen in Ungarn (s. Urteil vom 2. März 2021, Az. 36037/17, R.R. u.a. gg. Ungarn).
Kostentragungspflicht bei Erledigung der Hauptsache in Dublin-Verfahren
Erledigt sich die Klage gegen einen Dublin-Bescheid, weil die Zuständigkeit für die Prüfung des Asylantrags nach Ablauf der Überstellungsfrist auf Deutschland übergegangen ist, so sind die Verfahrenskosten jedenfalls dann vom beklagten Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu tragen, wenn es die Erledigung maßgeblich zu verantworten und letztlich herbeigeführt habe, meint das Verwaltungsgericht München in seinem Beschluss vom 10. August 2022 (Az. M 30 K 22.50371). Das Gericht geht davon aus, dass das BAMF eine Überwachungspflicht hat und den Ablauf des Überstellungsverfahrens kontrollieren muss. Außerdem müsse das BAMF kontinuierlich prüfen, ob nicht nachträglich Abschiebungshindernisse entstanden seien. Wenn die zuständigen Behörden (Ausländerbehörde, Polizei) nicht wenigstens versucht hätten, die Kläger in den für sie zunächst zuständigen Dublin-Staat zu überstellen, soll anscheinend davon ausgegangen werden, dass das BAMF seine Überwachungspflicht verletzt und die Erledigung somit zu verantworten hat.