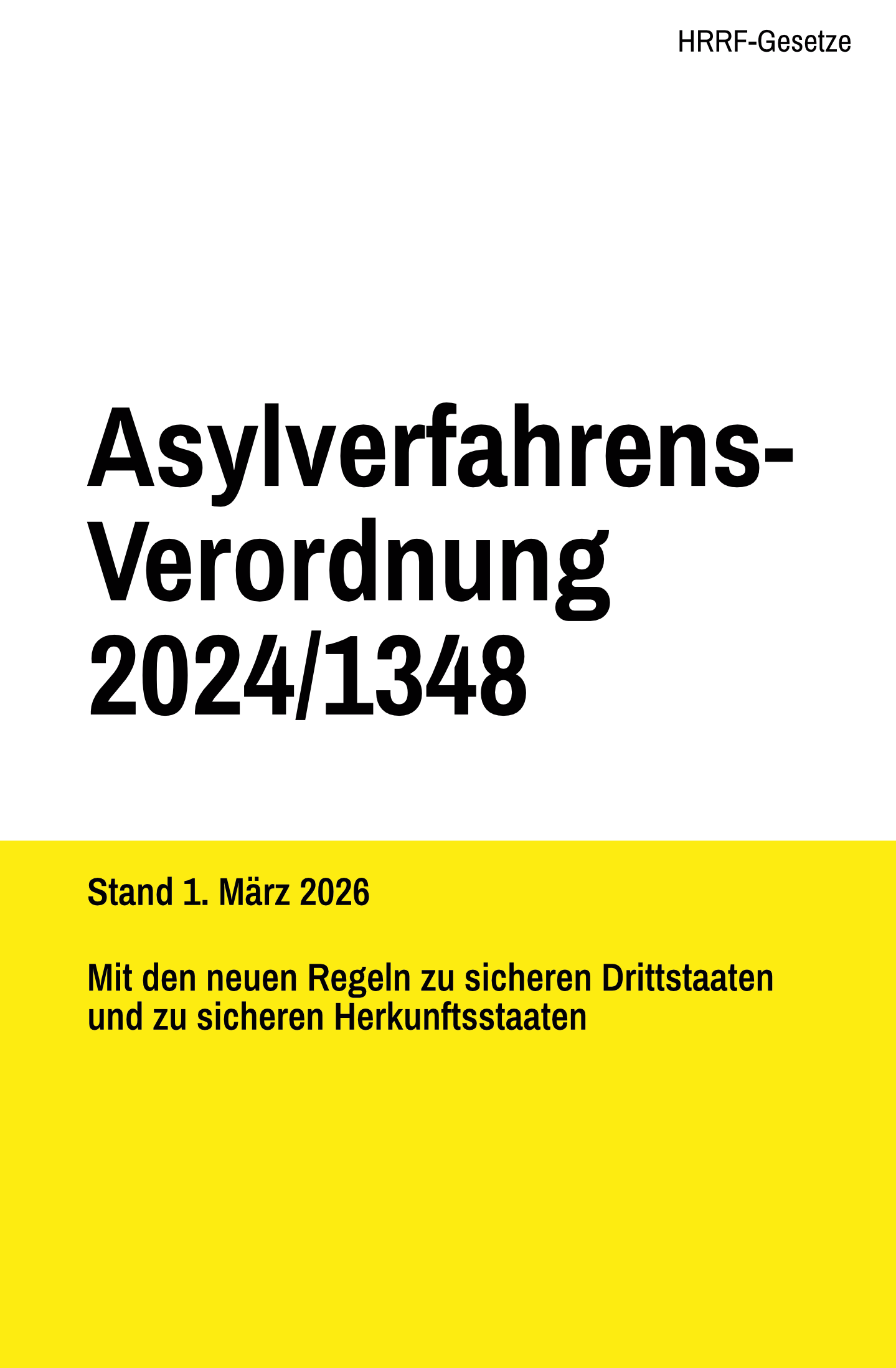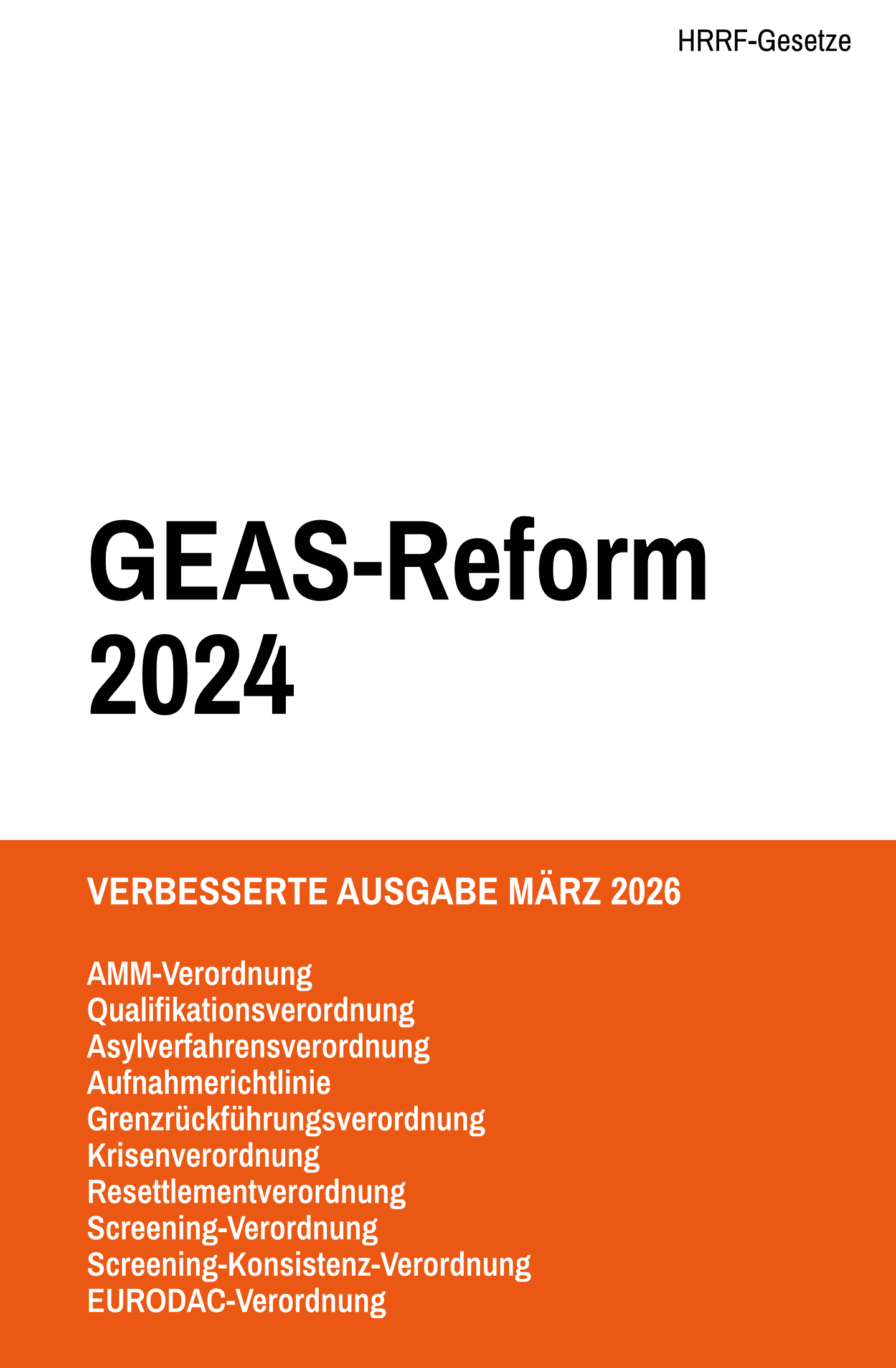In seinem Urteil vom 8. Mai 2025 (Rs. C-662/23) stellt der Europäische Gerichtshof klar, wie viel Zeit sich nationale Asylbehörden bei der Entscheidung über Asylanträge lassen dürfen, nämlich regelmäßig sechs Monate, und wann diese Frist verlängert werden kann, nämlich seltener als es bislang in der Praxis häufig der Fall sein dürfte.
In dem Verfahren ging es um die Auslegung von Art. 31 Abs. 3 Unterabs. 3 Buchst. b der EU-Asylverfahrensrichtlinie, der eine Verlängerung der behördlichen Entscheidungsfrist um neun Monate (d.h. auf 15 Monate) erlaubt, wenn „eine große Anzahl von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gleichzeitig internationalen Schutz beantragt, so dass es in der Praxis sehr schwierig ist, das Verfahren innerhalb der Frist von sechs Monaten abzuschließen“. Diese Vorschrift, so der Gerichtshof, sei restriktiv auszulegen und erlaube eine Verlängerung nur, wenn die Zahl der Asylanträge innerhalb eines kurzen Zeitraums angestiegen sei.
Dagegen rechtfertigten weder ein allmählicher Anstieg der Zahl der Anträge über einen langen Zeitraum noch praktische Schwierigkeiten wie eine große Menge nicht bearbeiteter Anträge oder eine unzureichende Zahl von Personal der nationalen Asylbehörde eine Verlängerung der Entscheidungsfristen. Gemäß Art. 4 Abs. 1 der Asylverfahrensrichtlinie müssten nationale Asylbehörden über kompetentes Personal in ausreichender Zahl verfügen und könne der kurze Zeitraum, der in Art. 31 der Richtlinie genannt werde, nicht länger sein als der Zeitraum, den die Behörde benötige, um Personal einzustellen und auszubilden, das für die angemessene und vollständige Bearbeitung der eingegangenen Anträge auf internationalen Schutz zuständig sei.
Da Art. 31 Abs. 3 der EU-Asylverfahrensrichtlinie weitgehend identisch mit § 24 Abs. 4 AsylG ist, wird die Entscheidung Auswirkungen auf die Entscheidungspraxis des Bundesamts haben müssen und die Qualität der Entscheidungen über Asylanträge vielleicht nicht zum Besseren beeinflussen. Gerichtsentscheidungen wie etwa die des Verwaltungsgerichts Düsseldorf im Februar 2024 (siehe HRRF-Newsletter Nr. 134), wonach Antragsteller mit einer Bescheidung ihrer Asylanträge im Regelfall nur innerhalb von 15 Monaten rechnen dürfen, kann es ab jetzt nicht mehr so einfach geben, und Bescheidungs- wie Untätigkeitsklagen (zum Unterschied siehe etwa das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Juli 2018, Az. 1 C 18.17) können ab jetzt häufig früher erhoben werden.