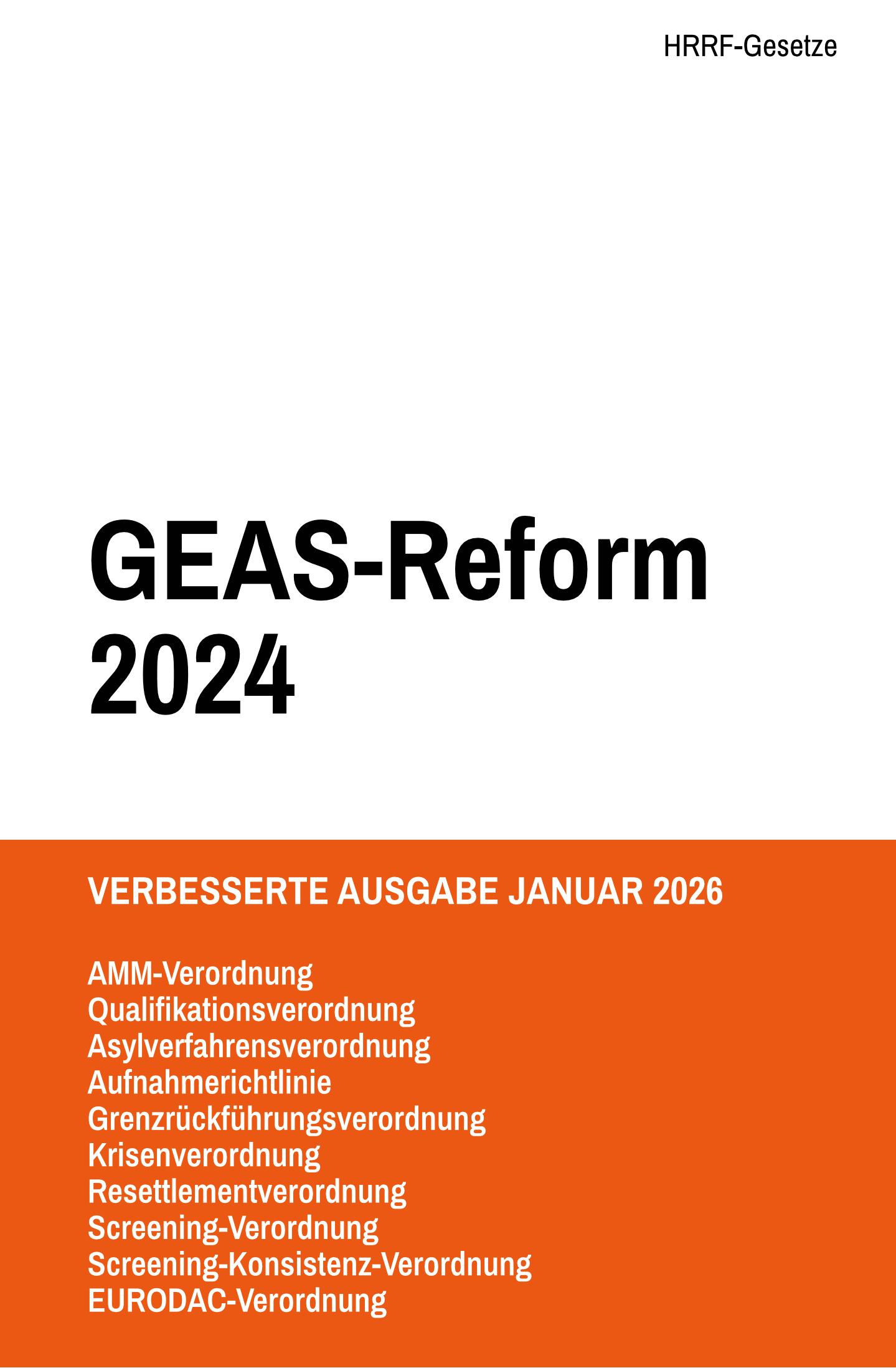Das Sommerloch fällt dieses Jahr aus – stattdessen geht es um subsidiären Schutz für syrische Flüchtlinge, um die Bargeldobergrenze bei der Bezahlkarte, um eine Abschiebung trotz einer entgegenstehenden gerichtlichen Eilentscheidung und um offene Fragen zum Schutz von aus der Ukraine geflüchteten Drittstaatsangehörigen. Außerdem kann subsidiärer Schutz bei einer Unterstützung der Hamas widerrufen werden, liegt bei Bestehen einer Möglichkeit zur Verfahrensfortsetzung in einem anderen Dublin-Staat kein Zweitantrag vor, muss belangloses Vorbringen „per se asylfremd“ sein, darf eine öffentliche Zustellung eines Asylbescheids nur als letztes Mittel genutzt werden, muss die Ausländerbehörde das Vorliegen eines Asylantrags selbstständig prüfen und greift der Beschwerdeausschluss gemäß § 80 AsylG nicht bei einem Antrag auf Verfahrensduldung.
Ausgabe
•
Per se asylfremd
-
Kein subsidiärer Schutz mehr für syrische Flüchtlinge
Das Oberverwaltungsgericht Münster berichtet in einer Pressemitteilung vom 22. Juli 2024 über sein Urteil vom 16. Juli 2024 (Az. 14 A 2847/19.A), in dem es entschieden hat, dass in Syrien für Zivilpersonen keine ernsthafte und individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts mehr besteht. Insbesondere fänden zwar etwa in der Provinz Hasaka noch bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und verbündeten Milizen einerseits und den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) andererseits statt und verübe der Islamische Staat dort gelegentlich Anschläge auf Einrichtungen der kurdischen Selbstverwaltung, die bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschläge erreichten jedoch kein solches Niveau mehr, dass Zivilpersonen beachtlich wahrscheinlich damit rechnen müssten, im Rahmen dieser Auseinandersetzungen und Anschläge getötet oder verletzt zu werden.
Das Urteil hat ein lebhaftes Medienecho hervorgerufen (siehe etwa hier, hier, hier und hier), eignet sich aber vielleicht gerade nicht so sehr als Leitentscheidung, weil der Kläger in dem Verfahren schon wegen von ihm begangener Straftaten von der Schutzgewährung ausgeschlossen war. Außerdem bedeutet es nicht, dass nun mit Abschiebungen nach Syrien zu rechnen ist, auch wenn diese Forderung als Reaktion auf das Urteil aus bestimmten Kreisen fast schon reflexhaft erhoben wurde. Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision nicht zugelassen.
-
Widerruf subsidiären Schutzes wegen Hamas-Unterstützung
Ideologisch-propagandistische Unterstützungshandlungen von einigem Gewicht zugunsten der terroristischen Vereinigung Hamas, die im maßgeblichen Zeitraum der Unterstützungshandlungen terroristische Handlungen begeht, sind als Handlungen anzusehen, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen widersprechen und die zum Ausschluss von der Zuerkennung subsidiären Schutzes führen können, meint das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Beschluss vom 11. Juni 2024 (Az. 34 L 29/24 A). Dabei komme es auf eine unmittelbare Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung nicht an, sondern auf eine individuelle Würdigung aller Umstände im Einzelfall, nach denen die Verantwortung des Betroffenen zu beurteilen sei. Nach der Resolution 1377 (2001) des UN-Sicherheitsrates liefen nicht nur terroristische Handlungen den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwider, sondern in ähnlicher Weise auch die Finanzierung, Planung, Vorbereitung und jede andere Form der Unterstützung von terroristischen Handlungen.
-
Kein Zweitantrag bei Möglichkeit zur Verfahrensfortsetzung in anderem Dublin-Staat
Ein in Deutschland gestellter Doppelantrag, d.h. ein Asylantrag, der gestellt wird, obwohl ein früherer Antrag in einem anderen Dublin-Staat noch anhängig oder eine Wiedereröffnung möglich ist, kann nicht als Zweitantrag gemäß § 71a AsylG behandelt werden, so dass eine Ablehnung des deutschen Asylantrags als offensichtlich unbegründet gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 8 AsylG nicht in Betracht kommt, sagt das Verwaltungsgericht Köln in seinem Beschluss vom 18. Juli 2024 (Az. 22 L 1313/24.A). Der maßgebliche Zeitpunkt sei dabei der Zeitpunkt der Asylantragstellung in Deutschland. In dem Verfahren habe der Kläger zunächst einen Asylantrag in Österreich gestellt, das Asylverfahren sei allerdings ohne inhaltliche Entscheidung eingestellt worden. Nach österreichischem Recht sei das österreichische Asylverfahren von Amts wegen fortzusetzen, falls der Antragsteller innerhalb von zwei Jahren nach Einstellung des Verfahrens wieder in Österreich aufhältig werde. Erst nach Ablauf von zwei Jahren nach Einstellung des Verfahrens sei eine Fortsetzung des Verfahrens gemäß § 24 Abs. 2 AsylG Österreich nicht mehr zulässig, und diese Frist sei zum Zeitpunkt der Antragstellung in Deutschland noch nicht abgelaufen gewesen.
-
Belangloses Vorbringen muss per se asylfremd sein
Das Tatbestandsmerkal der „Belanglosigkeit“ in § 30 Abs. 1 Nr. 1 AsylG setzt für die Ablehnung eines Asylantrags als offensichtlich unbegründet ein Vorbringen des Schutzsuchenden voraus, das von vorneherein keinen Bezug zu den die Schutzgewährung auslösenden Gefahren für den Schutzsuchenden beinhaltet, sagt das Verwaltungsgericht Düsseldorf in seinem Beschluss vom 12. Juli 2024 (Az. 7 L 1798/24.A). Entscheidend sei die Wertung, dass sämtliche vorgebrachten Gründe nicht nur nicht zu einer Schutzzuerkennung führten, sondern „per se asylfremd“ seien. Entgegen der Ansicht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in dem angefochtenen Bescheid finde eine materielle Evidenzprüfung des offensichtlichen Nichtvorliegens geltend gemachter Umstände in diesem Kontext nicht statt und sei die Begründung des Bundesamtes für seine Auffassung entlarvend, weil nach der dort vertretenen Ansicht das Tatbestandsmerkmal weiter auszulegen sei, weil es sonst keine Norm mehr gäbe, auf die eine Offensichtlichkeitswertung gestützt werden könnte. Warum das Bundesamt dann auch noch von vorneherein die erforderliche Eingriffsintensität für die einzelnen Elemente des Vorbringens verneine und ersichtlich zirkulär wegen der für zu niedrig befundenen Eingriffsintensität auf die Belanglosigkeit für die Asylantragsprüfung schließe, solle „das Geheimnis des angefochtenen Bescheides“ bleiben.
-
Öffentliche Zustellung nur als letztes Mittel
Eine öffentliche Zustellung eines Widerrufsbescheids gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG ist als letztes Mittel der Bekanntgabe nur dann zulässig, wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, das Schriftstück dem Empfänger in anderer Weise zu übermitteln, sagt das Verwaltungsgericht München in seinem Beschluss vom 10. Juli 2024 (Az. M 24 S 24.2755). Der Aufenthaltsort eines Ausländers im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG sei nicht schon dann unbekannt, wenn er dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht bekannt sei, vielmehr sei dies erst dann der Fall, wenn der Aufenthaltsort trotz der insoweit erforderlichen gründlichen und sachdienlichen Bemühungen um Aufklärung unbekannt geblieben sei. Wenn eine Kontaktaufnahme des Bundesamts mit der zuständigen Ausländerbehörde nicht ersichtlich sei, dann sei es zweifelhaft, ob das Bundesamt die erforderlichen gründlichen und sachdienlichen Bemühungen angestellt und alle Möglichkeiten erschöpft habe.
-
Offene Fragen zum Schutz von aus der Ukraine geflüchteten Drittstaatsangehörigen
Das Oberverwaltungsgericht Münster hält es in seinem Beschluss vom 11. Juli 2024 (Az. 18 B 1063/23) für offen, ob ein drittstaatsangehöriger Familienangehöriger eines ukrainischen Staatsangehörigen auch dann vom Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 erfasst wird und somit Schutz in der EU erhält, wenn zwar er selbst aus der Ukraine vertrieben wurde, nicht aber auch der ukrainische Staatsangehörige, dessen Familienangehöriger er ist. Der unter Art. 2 Abs. 1 Buchstabe c des Beschlusses verwendete Terminus der „unter den Buchstaben a und b genannten Personen“ lasse sich sprachlich so verstehen, dass er sich lediglich auf die unmittelbar zuvor genannten Personengruppen beziehen solle, oder so, dass die Bezugnahme auf die unter den Buchstaben a und b genannten Personen das im Einleitungssatz „vor die Klammer gezogene“ Erfordernis des Vertriebenseins mitumfasse, so dass auch Familienangehörige jeweils vertrieben worden sein müssten. Außerdem sei fraglich, ob bei einem Ehepaar, bei dem ein Ehepartner in der Ukraine verblieben, der andere aber für längere Zeit in ein Drittland ausgereist sei, die Familie in diesem Sinne noch gemäß Art. 2 Abs. 4 des Beschlusses in der Ukraine „anwesend und aufhältig“ gewesen sei. Da diese Fragen im Hauptsacheverfahren gegebenenfalls eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof erforderten, ließen sich weder ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsakts verneinen noch könne die offensichtliche Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bejaht werden.
-
Ausländerbehörde muss Vorliegen eines Asylantrags selbstständig prüfen
Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hält es in seinem Beschluss vom 14. März 2024 (Az. 3 D 37/23) für wahrscheinlich, dass eine Ausländerbehörde im Rahmen der Anwendung von § 10 Abs. 1 AufenthG selbstständig prüfen muss, ob ein Ausländer tatsächlich einen Asylantrag gestellt hat; § 10 Abs. 1 AufenthG verbietet in diesem Fall mit wenigen Ausnahmen die Erteilung eines Aufenthaltstitels vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asylverfahrens. Die Ausländerbehörde müsse, so das Oberverwaltungsgericht, bei unklaren Erklärungen des Ausländers im Wege der Auslegung ermitteln, ob es sich bei den Äußerungen um ein Schutzgesuch im Sinne von § 13 Abs. 1 AsylG handele und es sei nicht rein formal darauf abzustellen, ob das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Asylverfahren durchführe. Zwar könne es so zu divergierenden Entscheidungen zwischen Ausländerbehörde und Bundesamt hinsichtlich der Frage kommen, ob ein Asylantrag gestellt worden sei, was der Gesetzgeber aber wohl hinnehmen wollte. Im Übrigen gebe es auch keine § 42 AsylG entsprechende Norm, der eine Bindung der Ausländerbehörde an die Entscheidung des Bundesamts entnommen werden könne, ob ein Asylantrag gestellt wurde, und dürfte auch § 6 AsylG keine solche Wirkung entfalten, weil er einen gestellten Asylantrag gerade voraussetze.
-
Einzelfallentscheidung für Bargeldobergrenze erforderlich
In der soweit ersichtlich ersten Gerichtsentscheidung zur Bezahlkarte hat das Sozialgericht Hamburg mit Beschluss vom 18. Juli 2024 (Az. S 7 AY 410/24 ER) in einem Eilverfahren entschieden, dass die zuständigen Behörden bei der Bestimmung des Geldbetrags, der bei der Bezahlkarte in bar verfügbar ist, in jedem Einzelfall eine Entscheidung treffen müssen und nicht pauschal einen Betrag für Bargeldabhebungen festlegen dürfen. Den Behörden werde zwar ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt, jedoch müsse sich ihre Entscheidung nach den örtlichen Besonderheiten und unterschiedlichen Lebenslagen richten und damit insbesondere auch in der Person des Leistungsberechtigten liegende Besonderheiten berücksichtigen. Dies könne nur durch eine Einzelfallentscheidung geschehen, die einer starren Obergrenze entgegenstehe. Außerdem sei stelle sich jedenfalls grundsätzlich die Frage nach einer Ermächtigungsgrundlage für die Festlegung einer Bargeldobergrenze.
Das Sozialgericht hat die zuständige Behörde verpflichtet, jedenfalls Mehrbedarfe und Bedarfserhöhungen entweder durch eine Erhöhung des Barbetrags der Bezahlkarte der Kläger oder als bare Geldleistung zu gewähren. Das Verfahren wurde von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und von Pro Asyl unterstützt, die anlässlich dieser Entscheidung Pressemitteilungen veröffentlicht haben (siehe hier und hier).
-
Kein Beschwerdeausschluss bei Antrag auf Verfahrensduldung
Eine Rechtsstreitigkeit über Maßnahmen zum Vollzug einer auf § 34 AsylG beruhenden Abschiebungsandrohung nach dem AufenthG im Sinne von § 80 AsylG in der durch das Rückführungsverbesserungsgesetz geänderten Fassung liegt dann vor, wenn solche Vollzugsmaßnahmen den Streitgegenstand des Hauptsacheverfahrens bilden, meint der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in seinem Beschluss vom 5. Juli 2024 (Az. 12 S 821/24). Dies sei nicht der Fall, wenn ein Antrag auf Erteilung einer Verfahrensduldung gestellt wurde, weil die Verfahrensduldung allein der Sicherung eines behaupteten Anspruchs auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis diene. Das sehen andere Gerichte auch anders, etwa der Verwaltungsgerichtshof München in seinem Beschluss vom 30. April 2024 (Az. 19 CE 24.661).
-
Sächsische Abschiebungsbehörde ignoriert gerichtliche Eilentscheidung
Die Landesdirektion Sachsen, die in Sachsen unter anderem gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 SächsAAZuVO für Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung zuständig ist, hat am 11. Juli 2024 eine Abschiebung nach Marokko trotz eines dies untersagenden Eilbeschlusses des Verwaltungsgerichts Chemnitz fortgesetzt und den Eilbeschluss ignoriert. Das Verfahren ist allerdings insoweit unübersichtlich, als der Eilbeschluss sich gegen die örtliche Ausländerbehörde Chemnitz richtete, die für die Abschiebung nicht zuständig war. In Folge fühlten sich sowohl die örtliche Ausländerbehörde als auch die Landesdirektion nicht an den Eilbeschluss gebunden und wurde die Bundespolizei von keiner der beiden Behörden instruiert, die Abschiebung abzubrechen. Fünf Tage nach der Abschiebung verpflichtete das Verwaltungsgericht Chemnitz beide Behörden dazu, den abgeschobenen Ausländer innerhalb von sieben Tagen zurückzuholen, weil sie es „unter grober Missachtung ihrer Bindung an Recht und Gesetz“ unterlassen hätten, die Abschiebung auszusetzen. Dies wollte die örtliche Ausländerbehörde nicht akzeptieren und legte Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Bautzen ein, das ihr in zwei Beschlüssen vom 22. Juli 2024 (Az. 3 B 111/24 und 3 B 112/24) Recht gab, eben weil die örtliche Ausländerbehörde nicht zuständig sei. Das Oberverwaltungsgericht hat zu diesen Beschlüssen auch eine Pressemitteilung veröffentlicht. An der Rückholverpflichtung der Landesdirektion ändert sich nichts, weil sie gegen den Rückholbeschluss des Verwaltungsgerichts (noch) keine Rechtsmittel eingelegt hat.
Die Kommentarfunktion findet sich bei den einzelnen Beiträgen: Einfach auf die Überschrift klicken, um zum jeweiligen Beitrag zu gelangen.
Neu im Blog
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 6. Februar 2026
Indiz- und Bindungswirkung vorläufiger Maßnahmen des UN-Sozialauschusses?
20. Januar 2026
Im Oktober 2025 hat der UN-Sozialausschuss in einer Eilentscheidung entschieden, dass Deutschland einer vom Leistungsausschluss in Dublin-Fällen betroffenen Person existenzsichernde Leistungen gewähren muss. Dieser Beitrag analysiert die Entscheidung und beantwortet die Frage, ob ihr eine Indiz- und Bindungswirkung zukommt …
Dublin und die Drittstaaten
1. Januar 2026