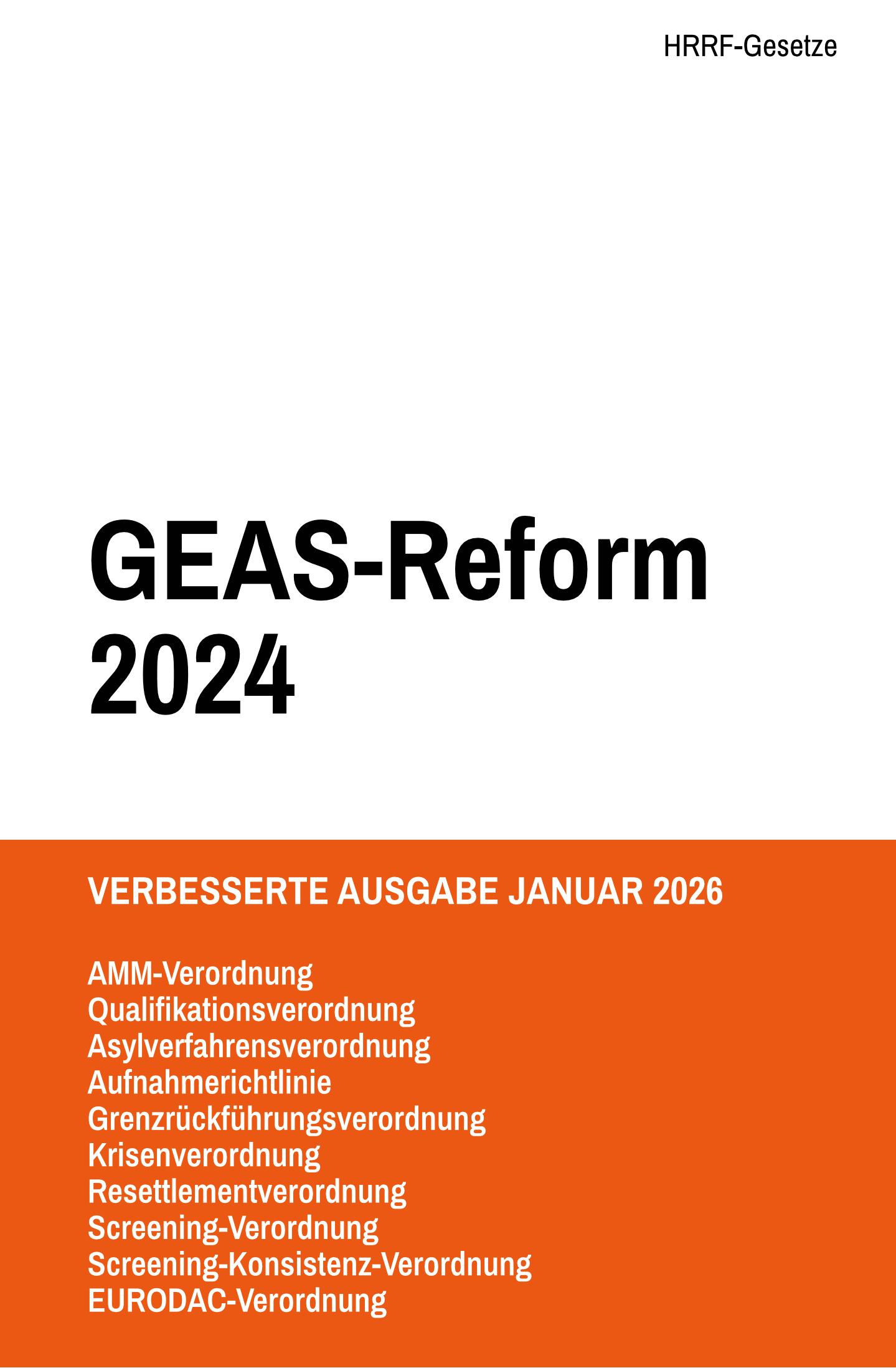In den HRRF-Newsletter haben es diese Woche gleich drei aktuelle Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts geschafft, in denen es um rechtswidrige Abschiebungen und verweigerte Akteneinsicht, um gerichtliche Benachrichtigungspflichten bei der Anordnung von Abschiebungshaft und um die Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde auch in Eilverfahren geht. Der Verwaltungsgerichtshof München nimmt derweil an, dass in Dublin-Fällen die Aufenthaltsgestattung bis zu einer tatsächlichen Überstellung fortbesteht, das Verwaltungsgericht München rügt ein bayerisches Jugendamt und das Verwaltungsgericht Regensburg erläutert, wann ein Asylantrag ein Zweitantrag ist. Litauen schließlich hat Belarus vor dem Internationalen Gerichtshof verklagt, und zwar ausgerechnet wegen einer Verletzung des Völkerrechts beim Umgang mit Migranten und Schutzsuchenden.
Ausgabe
•
Rechtsstaatliche Gesichtspunkte
-
Bundesverfassungsgericht rügt verweigerte Akteneinsicht und rechtswidrige Abschiebung
In seinem Beschluss vom 18. März 2025 (Az. 2 BvR 1113/24) hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die im Kontext der Folgenbeseitigung einer rechtswidrigen Abschiebung aus Sachsen nach Marokko im Juli 2024 (siehe ausführlich HRRF-Newsletter Nr. 155) getroffene Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen, dem Rechtsanwalt des bereits abgeschobenen Ausländers Akteneinsicht zu verwehren, weil es auf die Kenntnis des Akteninhalts nicht ankomme und ihr ohnehin eine besondere Eilbedürftigkeit entgegenstehe, rechtswidrig war und das aus Art. 19 Abs. 4 GG folgende Grundrecht des Beschwerdeführers auf effektiven Rechtsschutz verletzt hat. In dem Argument, dass es auf Inhalt und Kenntnis der Akte für das Verfahren nicht ankomme, zeige sich ein grundlegendes Missverständnis von der Bedeutung der Akteneinsicht, die grundsätzlich nicht zur Disposition des Staates und seiner Institutionen stehe, da das Oberverwaltungsgericht schlicht nicht darüber befinden dürfe, ob der Akteninhalt für den Beschwerdeführer wesentlich sei oder nicht. Dieses Fehlverständnis des Oberverwaltungsgerichts gewinne noch dadurch an Gewicht, dass dem Beschwerdeführer an anderer Stelle der angefochtenen Entscheidung unzureichendes Vorbringen vorgehalten werde. Daneben sei auch nicht nachvollziehbar, inwiefern die Gewährung von Akteneinsicht zu einer weiteren und relevanten Verfahrensverzögerung hätte führen sollen, zumal nach der bereits erfolgten Abschiebung des Beschwerdeführers kein außergewöhnlicher Zeitdruck mehr bestanden hätte.
Dieser Beschluss zeigt einmal mehr, wie Gerichte mitunter den rechtsstaatlichen Maßstab für die Kontrolle und Korrektur behördlicher Fehlentscheidungen aus den Augen verlieren. Zur bereits vom Verwaltungsgericht Chemnitz festgestellten Rechtswidrigkeit der Abschiebung wegen der Missachtung einer verwaltungsgerichtlichen Eilentscheidung hat das Bundesverfassungsgericht lediglich in einem Nebensatz ausgeführt, dass diese Missachtung unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht nachvollziehbar sei. Der HRRF-Newsletter berichtet leider regelmäßig über Abschiebungen, bei denen Behörden gerichtliche Eilentscheidungen ignorieren, zuletzt in Ausgabe Nr. 186.
-
Fortbestehen der Aufenthaltsgestattung trotz Dublin-Unzuständigkeit
Der Verwaltungsgerichtshof München geht in seinem Urteil vom 21. Mai 2025 (Az. 19 B 24.1772) davon aus, dass der Eintritt der Vollziehbarkeit einer Abschiebungsanordnung in Dublin-Verfahren entgegen dem Wortlaut von § 67 Abs. 1 Nr. 5 AsylG nicht zum Erlöschen der Aufenthaltsgestattung des Betroffenen führt, sondern der Aufenthalt bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Vollzugs der Dublin-Überstellung rechtmäßig bleibt. Das liege daran, so der Verwaltungsgerichtshof, dass die vorrangig vor dem deutschen Recht anzuwendende EU-Asylverfahrensrichtlinie auch für Dublin-Verfahren gelte und dass das Aufenthaltsrecht der Antragsteller während des Asylverfahrens gemäß Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie erst mit einer bestandskräftigen inhaltlichen Entscheidung über den Asylantrag erlösche. Die Ablehnung eines Asylantrags als unzulässig wegen der Zuständigkeit eines anderen Dublin-Staats sei aber gerade keine inhaltliche Ablehnung des Asylantrags, so dass das Aufenthaltsrecht fortbestehe, und zwar eben bis zur tatsächlichen Durchführung der Dublin-Überstellung. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache zugelassen.
Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zeigt eindrucksvoll, wie komplex das Neben- und Miteinander von deutschem und europäischem Recht inzwischen geworden ist und zu welchen auf den ersten Blick überraschenden Schlussfolgerungen man bei der Ermittlung der letztlich geltenden Rechtsnormen gelangen kann. Die praktischen Auswirkungen des Urteils sind jedenfalls bis zum Inkrafttreten der GEAS-Reform (siehe Art. 10 Abs. 1 Asylverfahrens-Verordnung 2024/1348) vielfältig, weil es im Aufenthaltsrecht immer mal wieder auf einen gerade legalen Voraufenthalt ankommt, wie etwa in diesem Verfahren beim Chancen-Aufenthalt (§ 104c Abs. 1 AufenthG). Die neuen Dublin-Leistungskürzungen gemäß § 1 Abs. 4 AsylbLG dürften ebenso von dem Urteil betroffen und nun noch aus einer weiteren Erwägung heraus grundsätzlich rechtswidrig sein.
-
Keine Abschiebungshaft ohne Benachrichtigung von Angehörigen oder einer Vertrauensperson
Es verstößt gegen das aus Art. 104 Abs. 4 GG folgende Grundrecht, wenn Haftgerichte Angehörige oder eine Person des Vertrauens von in Abschiebungshaft genommenen Ausländern nicht über die Haftanordnung benachrichtigen, sagt das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 16. April 2025 (Az. 2 BvR 845/22). Zweck des Art. 104 Abs. 4 GG sei es, einer in Haft genommenen Person den Kontakt nach außen zu sichern und damit ein spurloses Verschwinden von Personen zu verhindern. Das Amtsgericht habe gegen die ihm obliegenden Pflichten bereits dadurch verstoßen, dass es den Beschwerdeführer lediglich auf die „Möglichkeit“ hingewiesen habe, einen Angehörigen oder eine Vertrauensperson von seiner Inhaftierung zu benachrichtigen, und nicht dokumentiert habe, wie der Beschwerdeführer reagiert habe und warum das Gericht schlussendlich von einer Benachrichtigung abgesehen habe. Das ebenfalls involvierte Landgericht habe das Grundrecht des Beschwerdeführers ebenfalls verletzt, weil es seine eigene nachträgliche Einschätzung an die Stelle der Entscheidung des Amtsgerichts gesetzt und angenommen habe, dass der Beschwerdeführer auf die Wahrnehmung seines Rechts verzichtet habe.
Neu ist diese Rechtsprechung nicht, bereits im Dezember 2023 (siehe ausführlich HRRF-Newsletter Nr. 130) hatte das Bundesverfassungsgericht in drei Verfahren Grundrechtsverletzungen bei unterlassenen Benachrichtigungen festgestellt und den Haftgerichten detaillierte Verhaltenshinweise mit auf den Weg gegeben. Das Gericht erklärt noch einmal die Bedeutung des Grundrechts und präzisiert die den Haftgerichten obliegenden Aufgaben.
-
Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde auch in Eilverfahren
In seinem Beschluss vom 10. April 2025 (Az. 2 BvR 487/25) hat das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung einer Duldung nicht zur Entscheidung angenommen, weil der Beschwerdeführer aus Sicht des Gerichts zuvor nicht alle zumutbaren Rechtsschutzmöglichkeiten ausgeschöpft hatte. In dem Verfahren ging es im Rahmen der Nachholung des Visumverfahrens um einen Verbleib in Deutschland bis zur Wahrnehmung eines Termins bei der zuständigen deutschen Auslandsvertretung, was die zuständige Behörde erst einige Tage nach einem in dem Verfahren gemäß § 123 VwGO ergangenen ablehnenden gerichtlichen Eilbeschluss verweigert hatte. Die zuständige Behörde habe, so das Bundesverfassungsgericht, erst nach der ablehnenden gerichtlichen Eilentscheidung mitgeteilt, dass sie an der Verneinung des Duldungsanspruchs festhalte, was als geänderter Umstand im Sinne einer analogen Anwendung von § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO anzusehen sein könnte. Entsprechend hätte der Beschwerdeführer zunächst versuchen müssen, beim Verwaltungsgericht eine Abänderung des zuvor gefassten Eilbeschlusses zu erreichen.
Die Details des Verfahrens werden in dem Beschluss zwar nicht sonderlich klar beschrieben, offenbar hatte das Verwaltungsgericht aber nicht über den vorläufigen Verbleib des Betroffenen in Deutschland entschieden, sondern lediglich über andere Aspekte des Verfahrens, so dass ein anschließender Abänderungsantrag tatsächlich so fern nicht gelegen hätte.
-
Immer noch kein Zweitantrag vor Abschluss des Erstverfahrens
Die Ablehnung eines Asylantrags als unzulässiger Zweitantrag gemäß § 71a AsylG ist nur möglich, so das Verwaltungsgericht Regensburg in seinem Urteil vom 14. Mai 2025 (Az. RO 14 K 23.31483), wenn das vorherige Asylverfahren im Zeitpunkt der Antragstellung tatsächlich bestandskräftig abgeschlossen ist. Dies folge jedenfalls aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Dezember 2024 (Rs. C-123/23 und C-202/23) (siehe dazu HRRF-Newsletter Nr. 177), würde aber auch sonst gelten, weil bereits zu Beginn des Asylverfahrens geklärt sein müsse und nicht erst im Nachhinein, welche Art von Asylverfahren in Deutschland durchgeführt werde. Außerdem hätte es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sonst in der Hand, durch ein beliebiges „Herauszögern“ des Abschlusses des Asylverfahrens in Deutschland selbst zu entscheiden, ob es sich um einen Erstantrag oder um einen Zweitantrag handele.
Die Rechtslage ist seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs geklärt, so dass das Verwaltungsgericht es sich einfach hätte machen können. Das hat es aber nicht getan, sondern fast schon nostalgisch ausführlich die alte und nicht mehr relevante Rechtslage und die zu ihr vormals vertretenen divergierenden Auffassungen referiert. Es ist vermutlich einfach weniger Aufwand bei der Urteilsabfassung, wenn existierende und bislang bewährte Textbausteine lediglich um einen zusätzlichen Hinweis ergänzt werden.
-
Grob rechtswidrige Einstellung von Leistungen der Jugendhilfe
Das Verwaltungsgericht München kritisiert in seinem Beschluss vom 14. Mai 2025 (Az. M 18 E 25.2820) in überaus deutlichen Worten die Praxis eines bayerischen Jugendamts, über Maßnahmen der Jugendhilfe für heranwachsende Ausländer gemäß §§ 34, 41 SGB VIII letztlich ohne jede Einzelfallprüfung zu entscheiden. Das „grob rechtswidrige“ Vorgehen der Behörde, die Entscheidung über eine Leistungseinstellung ausschließlich aufgrund der Volljährigkeit der Betroffenen und ohne jede Bedarfsfeststellung oder sozialpädagogische Beurteilungsgrundlage zu treffen, verkenne Grundsätze des Jugendhilferechts und setze sich mutwillig über diese Grundsätze hinweg.
Es scheint sich nicht um einen Einzelfall zu handeln, weil das Verwaltungsgericht in seinem Beschluss ausführt, dass ihm das Vorgehen der Behörde aus parallelen Verfahren bekannt sei. Wer sich übrigens wundert, warum die Verwaltungsgerichte und nicht die Sozialgerichte für Fragen des Jugendhilferechts zuständig sind: Das liegt daran, dass der in § 51 SGG geregelte Zuständigkeitskatalog für die Sozialgerichtsbarkeit das Kinder- und Jugendhilferecht nicht nennt, so dass es bei der allgemeinen, aus § 40 VwGO folgenden Auffangzuständigkeit der Verwaltungsgerichte bleibt. Geht es nach dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung (dort Zeile 473ff.), dann wird sich das bald ändern und sollen stattdessen die Sozialgerichte zuständig werden.
-
Litauen verklagt Belarus vor dem Internationalen Gerichtshof
Litauen hat beim Internationalen Gerichtshof am 19. Mai 2025 eine Klage gegen sein Nachbarland Belarus eingereicht und wirft ihm vor, das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu verletzen. Belarus unterstütze die Schleusung von Migranten und sichere seine Grenzen nicht ausreichend. Außerdem verhindere Belarus nicht, dass Migranten zu Opfern krimineller Gruppen würden, schütze die Rechte der Migranten nicht und gewähre ihnen keine Unterstützung. Das verletze nicht nur die Souveränität, Sicherheit und die öffentliche Ordnung Litauens, sondern auch die Rechte der betroffenen Migranten. Der Gerichtshof berichtet über den Eingang der Klage auch in einer Pressemitteilung.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Litauen sich gegenüber Belarus auf das Völkerrecht beruft und beklagt, dass das Land die Rechte von Migranten verletzt, es selbst aber mit dem Völkerrecht und den aus ihm folgenden Menschenrechten auch nicht so genau nimmt, wenn es um Pushbacks an seinen Grenzen und die Abwehr von Schutzsuchenden geht (siehe etwa die HRRF-Newsletter Nr. 12, 34, 52, 150, 152 und 183). Wie immer das Verfahren ausgehen wird, mehr als eine nur symbolische Bedeutung wird es nicht haben. Immerhin bietet es Gelegenheit, sich mit einem eher exotischen Teilbereich des Migrationsrechts zu beschäftigen.
Die Kommentarfunktion findet sich bei den einzelnen Beiträgen: Einfach auf die Überschrift klicken, um zum jeweiligen Beitrag zu gelangen.
Neu im Blog
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 21. Januar 2026
Indiz- und Bindungswirkung vorläufiger Maßnahmen des UN-Sozialauschusses?
20. Januar 2026
Im Oktober 2025 hat der UN-Sozialausschuss in einer Eilentscheidung entschieden, dass Deutschland einer vom Leistungsausschluss in Dublin-Fällen betroffenen Person existenzsichernde Leistungen gewähren muss. Dieser Beitrag analysiert die Entscheidung und beantwortet die Frage, ob ihr eine Indiz- und Bindungswirkung zukommt …
Dublin und die Drittstaaten
1. Januar 2026