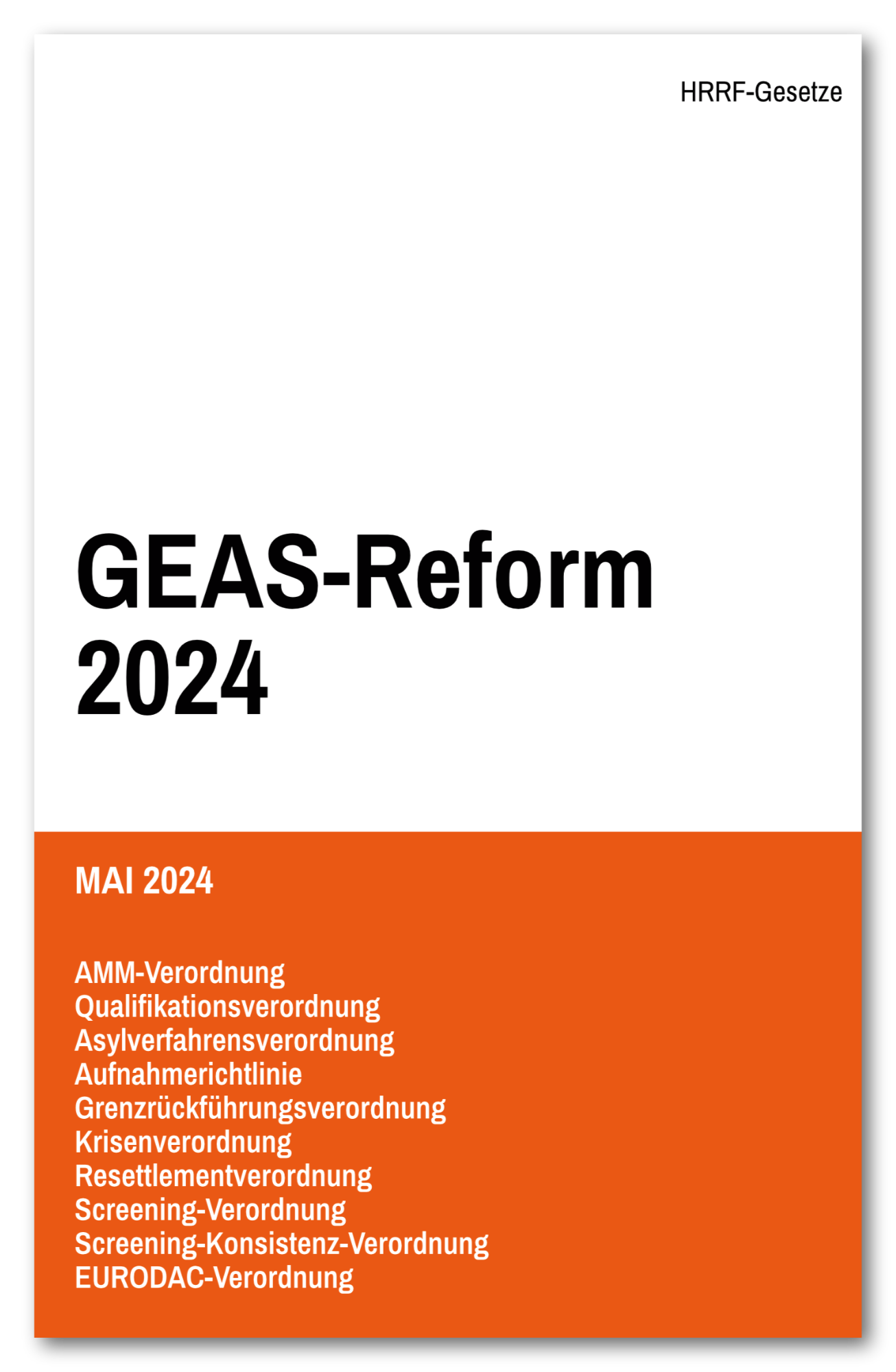Eilt Eilt!
Ungarn (erneut) vom Europäischen Gerichtshof verurteilt
In dem Vertragsverletzungsverfahren C-821/19 (Kommission/Ungarn) hat der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 16. November 2021 festgestellt, dass Ungarn mit der Einführung von besonderen Unzulässigkeitsgründen für Asylanträge, der Kriminalisierung der Unterstützung von Asylsuchenden und dem Verbot für solcher Straftaten Verdächtigter, sich der ungarischen Grenze zu nähern, gegen die Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU sowie die Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU verstoßen hat; eine Zusammenfassung des Urteils ist als Pressemitteilung verfügbar.
Im Fokus des Urteils steht die ungarische Regelung, die die Unterstützung der Asylantragstellung für strafbar erklärte, wenn jenseits vernünftiger Zweifel nachgewiesen werden konnte, dass die unterstützende Person wusste, dass der Asylantrag nach dem innerstaatlichen ungarischen Recht keine Aussicht auf Erfolg hatte. Diese Regelung sei dazu geeignet, so der EuGH, jede Person, die in irgendeiner Form eine Unterstützung bei der Stellung oder förmlichen Stellung eines Asylantrags gewähren möchte, unabhängig davon, in welcher Eigenschaft sie dies tue, in hohem Maße abzuschrecken, obwohl die Unterstützung einzig und allein darauf abziele, es einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen zu ermöglichen, von seinem Grundrecht Gebrauch zu machen, in einem Mitgliedstaat um Asyl nachzusuchen.
Das Urteil ist angesichts des absurden und perfiden Versuchs einer Kriminalisierung der Unterstützung von Asylsuchenden in Ungarn nicht überraschend. Es ist vielleicht nicht zu erwarten, dass Ungarn dem Urteil nachkommen und seine betroffenen Rechtsvorschriften aufheben wird. In einem vergleichbaren Verfahren (Rechtssache C-808/18), in dem der EuGH im Dezember 2020 festgestellt hatte, dass ungarische Rechtsvorschriften über die Regeln und Verfahren in den Transitzonen an der serbisch-ungarischen Grenze gegen EU-Recht verstießen, hat die Europäische Kommission am 12. November 2021 beschlossen, wegen der Nichtbefolgung des Urteils durch Ungarn die Verhängung finanzieller Sanktionen zu beantragen.
Verletzung der EMRK durch Pushback und Tod an kroatisch-serbischer Grenze
Im Verfahren M.H. u.a. gegen Kroatien hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil vom 18. November 2021 (Az. 15670/18 und 43115/18) eine Verletzung von Art. 2, 3, 5 und 34 der EMRK sowie von Art. 4 des vierten Zusatzprotokolls zur EMRK festgestellt, nachdem eine afghanische Familie Ende 2017 an der kroatisch-serbischen Grenze zurückgewiesen worden war und ein sechsjähriges Kind zu Tode kam. In dem komplexen Fall, zu dem der EGMR auch eine umfangreiche Pressemitteilung veröffentlicht hat, werden zahlreiche Detailfragen zu den aus der EMRK für Asylsuchende folgenden Rechten diskutiert, darunter in Auseinandersetzung mit dem Urteil des Gerichtshofs im Verfahren N.D. und N.T. gegen Spanien vom 13. Februar 2020. Der Fall ist so tragisch und von leider erschreckender Aktualität.
Substantiierungsanforderungen für verfassungsgerichtliche Eilanträge
Mit Beschluss vom 20. Oktober 2021 (Az. 2 BvQ 95/21), der separat begründet wurde, hat das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag auf Aussetzung einer Abschiebung nach Nigeria abgelehnt, den der Antragsteller mit seinen familiären Bindungen in Deutschland und dem laufenden Asylverfahren seiner Tochter begründet hatte. Nach Ansicht des BVerfG habe der Antragsteller nicht hinreichend substantiiert dargelegt, welche konkreten Nachteile ihm und seiner Familie im Falle seiner Abschiebung drohten, insbesondere in Hinblick darauf, dass er sich nicht mit der Argumentation der Ausländerbehörde in ihrer Erwiderung im fachgerichtlichen Eilverfahren auseinandergesetzt habe, wonach die Familiengemeinschaft alsbald in Nigeria wiederhergestellt werden könne; ein lediglich schlagwortartiger Verweis auf die seiner Tochter in Nigeria drohende Genitalverstümmelung sei nicht ausreichend. Der Beschluss ist insofern bedauerlich, als der Eilantrag offenbar in großer Zeitnot beim BVerfG eingereicht wurde, nämlich erst etwa 2 Stunden vor der geplanten Abschiebung des Antragstellers, und insofern möglicherweise über die vom Gericht zugestandenen reduzierten Begründungsanforderungen hinaus ein Nachlass hätte gewährt werden können.
Nichtzulassungsbeschwerde muss entscheidungserhebliche Frage aufwerfen
Das Bundesverwaltungsgericht ruft mit seinem Beschluss vom 7. September 2021 (Az. 1 B 50.21) in Erinnerung, dass bei einer Nichtzulassungsbeschwerde, die die grundsätzliche Bedeutung einer Rechtssache behaupte, die aufgestellte Rechtsfrage auch entscheidungserheblich sein müsse. Daran fehle es im konkreten Verfahren, weil die Beschwerde Fragen zur öffentlichen Religionsausübung von Ahmadis in Pakistan aufwerfe, während nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für den Kläger eine verfolgungsträchtige öffentlichkeitswirksame Religionsausübung nicht identitätsprägend sei. Der Beschluss zeigt die Schwierigkeiten, die entstehen, wenn im Berufungsverfahren Weichen falsch gestellt werden.
Dublin-Überstellungen nach Italien haben keine grundsätzliche Bedeutung
Die Frage, ob derzeit Familien mit minderjährigen Kindern ohne individuelle Zusicherung der italienischen Behörden im Dublin-Verfahren nach Italien überstellt werden können, hat für den Verwaltungsgerichtshof München keine grundsätzliche Bedeutung, der mit Beschluss vom 10. November 2021 (Az. 14 ZB 21.50043) einen Antrag auf Berufungszulassung in einem solchen Fall abgelehnt hat. Die Antragsbegründung, so der VGH, lege die Klärungsbedürftigkeit nicht hinreichend dar, auch nicht in Auseinandersetzung mit den Entscheidungen des OVG Münster vom 20. Juli 2021, die einen gänzlich anders gelagerten Sachverhalt beträfen. Dieser Beschluss verdeutlicht einmal mehr, welche hohen Anforderungen an die Begründung eines Antrags auf Zulassung der Berufung im Asylverfahren gestellt werden.
Kein Schutz vor Abschiebung nach Eritrea
In seinem Urteil vom 27. Oktober 2021 (Az. 4 Bf 106/20.A) hat das Oberverwaltungsgericht Hamburg (erneut) die Gewährung subsidiären Schutzes und von Abschiebungsschutz für eine Eritreerin abgelehnt. Es sei im Regelfall weder beachtlich wahrscheinlich, dass erwachsene Eritreer bei einer Rückkehr eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG dadurch erlitten, dass sie (erneut) in den Nationaldienst einberufen oder aufgrund der illegalen Ausreise und der damit verbundenen Umgehung der Nationaldienstverpflichtung bestraft würden, noch sei es Eritreern, die im Ausland lebten und sich nicht exilpolitisch-oppositionell betätigt hätten, unzumutbar, den sog. Diasporastatus zu erlangen, der nach gegenwärtiger Erkenntnislage bei einer dauerhaften Rückkehr nach Eritrea für einen Zeitraum von mindestens sechs bis zwölf Monaten sowohl vor einer erneuten Einberufung in den Nationaldienst als auch vor einer etwaigen Bestrafung schütze, außerdem sei es nicht beachtlich wahrscheinlich, dass Frauen mit Kindern in den militärischen Teil des Nationaldienstes einberufen würden. Die Anforderungen eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 AufenthG i. V. m. Art. 3 EMRK seien derzeit auch angesichts der angespannten Versorgungslage in Eritrea unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie jedenfalls dann nicht erfüllt, wenn der Schutzsuchende bei seiner Rückkehr die Hilfe seiner Familie und zusätzlich finanzielle Rückkehrhilfen im Rahmen der Programme REAG/GARP und StarthilfePlus in Anspruch nehmen könne. Das Urteil ist immerhin ausführlich begründet.
Terminverlegungsantrag für Haftanhörung muss gestellt werden
Wolle der Verfahrensbevollmächtigte eines von Abschiebungshaft Betroffenen an einem Termin zur persönlichen Anhörung teilnehmen, sei ihm dies aber wegen der Kurzfristigkeit der Terminbestimmung nicht möglich, so müsse er dies zweifelsfrei deutlich machen und einen Antrag auf Terminverlegung stellen, so der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 31. August 2021 (Az. XIII ZB 96/19). Die bloße Mitteilung des Verfahrensbevollmächtigten, dass ihm wegen der Kurzfristigkeit der Terminierung eine Anreise zum Termin nicht möglich sei, ersetze einen solchen Antrag nicht, insbesondere auch nicht der Vermerk „Eilt Eilt!“ in einer solchen Mitteilung. Der BGH balanciert mit diesem Beschluss die Verteilung der Verantwortung für die Gewährleistung des Rechts auf ein faires Verfahren, die nicht nur bei den Haftgerichten, sondern eben auch bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten liegt.
Rechtliches Gehör bei bevorstehendem Ablauf des Haftzeitraums
Ein wegen Ablaufs der Haft- oder Gewahrsamszeit oder des Datums der geplanten Abschiebung oder Überstellung unmittelbar bevorstehendes Haftende rechtfertige es nicht, zulasten eines Beteiligten auf die Gewährung rechtlichen Gehörs zu verzichten, so der Bundesgerichtshof in seinem Beschluss vom 22. Juni 2021 (Az. XIII ZB 88/20). Könne das Haftaufhebungs-, Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor der Abschiebung oder Überstellung nicht verfahrensordnungsgemäß abgeschlossen werden, habe die beteiligte Behörde die Möglichkeit, das Verfahren durch eine Beschränkung auf den Kostenpunkt fortzuführen. Das Verfahren war dem BGH einen (vielleicht missverständlichen) Leitsatz wert.