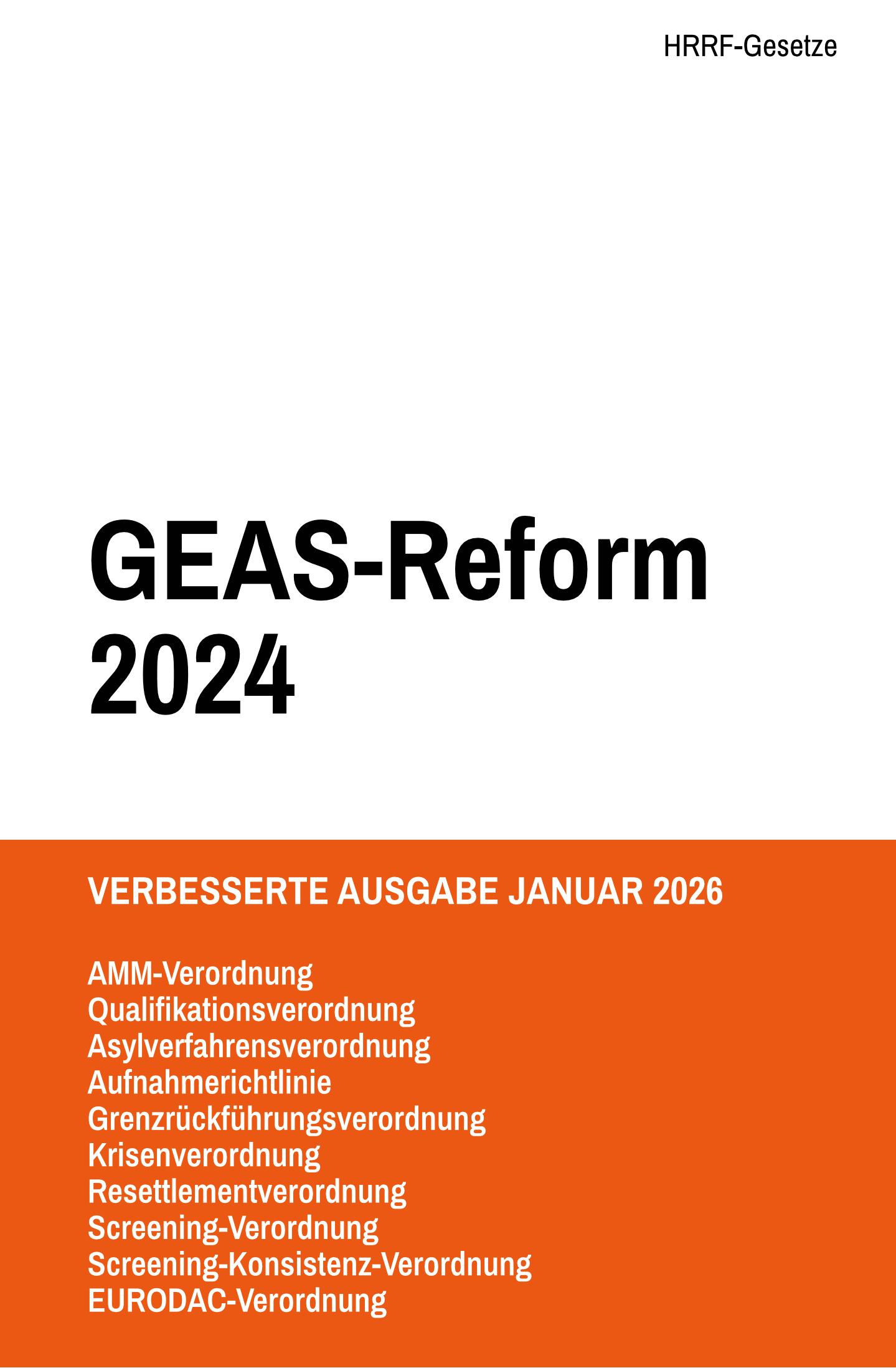Es sah lange nach einer ruhigen Woche aus, nun gibt es aber doch einiges zu berichten. Der EuGH beschäftigt sich mit subjektiven Nachfluchtgründen, das OVG Koblenz mit Eritrea, das VG Düsseldorf mit der Arbeitsbelastung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge und der VGH München mit der Unterbringung von nachgezogenen Familienangehörigen. Außerdem gibt es neue Fragen zu Dublin-Statistiken und, als Wochenendlektüre, zehn asylpolitische Beiträge im Verfassungsblog.
Ausgabe
•
Sonstige Sekundärmigration
-
EuGH erklärt subjektive Nachfluchtgründe bei Religionswechsel
In seinem Urteil vom 29. Februar 2024 (Rs. C-222/22) erläutert der Europäische Gerichtshof sehr ausführlich und sehr grundsätzlich, wie die etwas missverständliche Formulierung in Art. 5 Abs. 3 der EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU zu verstehen ist, wonach es EU-Mitgliedstaaten bei Vorhandensein einer entsprechenden nationalen Regelung erlaubt ist, einen Folgeantrag „unbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention“ und „in der Regel“ abzulehnen, wenn die geltend gemachte Verfolgungsgefahr auf vom Antragsteller nach Verlassen seines Herkunftslandes „selbst geschaffenen Umständen“ beruht, etwa auf einem Religionswechsel. Ein solcher Folgeantrag darf jedenfalls nicht automatisch als rechtsmissbräuchlich abgelehnt werden, sagt der Gerichtshof, sondern nur dann, wenn der Antrag auf eine positiv festgestellte Missbrauchsabsicht und die Absicht zurückzuführen ist, das Verfahren für die Zuerkennung internationalen Schutzes zu „instrumentalisieren“.
Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie habe Ausnahmecharakter und sei deshalb eng auszulegen, außerdem sei eine Auslegung unter Beachtung der Genfer Flüchtlingskonvention vorzunehmen, die keine Einschränkung im Hinblick darauf vorsehe, dass die begründete Furcht vor Verfolgung auf Aktivitäten des Antragstellers nach Verlassen des Herkunftslands beruhen könne, die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits dort bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung seien. Die Wendung „selbst geschaffene Umstände“ ziele darauf ab, eine Missbrauchsabsicht des Antragstellers zu ahnden, der die Umstände, auf denen die Verfolgungsgefahr beruhe, der er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland ausgesetzt wäre, „durch eigenes Zutun erzeugt“ und damit das anwendbare Verfahren für die Zuerkennung internationalen Schutzes instrumentalisiert habe (auf eine bloße Kausalität wird es dabei nicht ankommen können, weil der Gerichtshof im Kontext des Religionswechsels auch ausführt, dass bei einer Konversion „aus innerer Überzeugung“, die ja irgendwie auch durch eigenes Zutun erzeugt wurde, eine Missbrauchsabsicht ausgeschlossen sei).
Die Feststellung einer Missbrauchsabsicht und der Absicht, das anwendbare Verfahren zu instrumentalisieren, erfordere eine individuelle Prüfung des Antrags anhand aller in Rede stehenden Umstände durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, wobei alle relevanten Tatsachen zu berücksichtigen seien. Daraus folge, dass Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie entgegen dem Vorbringen der österreichischen und der deutschen Regierung nicht dahin ausgelegt werden könne, dass die fakultative Umsetzung dieser Bestimmung die Mitgliedstaaten davon befreie, die zuständigen nationalen Behörden zu verpflichten, jeden Folgeantrag auf internationalen Schutz individuell zu prüfen. Diese Bestimmung könne auch nicht dahin ausgelegt werden, dass eine solche Umsetzung es den Mitgliedstaaten erlaube, eine vom Antragsteller zu widerlegende Vermutung aufzustellen, wonach jeder Folgeantrag, der auf Umständen beruht, die der Antragsteller nach Verlassen des Herkunftslands selbst geschaffen hat, auf eine Missbrauchsabsicht und die Absicht zurückzuführen sei, das Verfahren für die Zuerkennung internationalen Schutzes zu instrumentalisieren. Eine solche Auslegung würde nämlich Art. 4 der Richtlinie, der eine individuelle und umfassende Prüfung aller Anträge auf internationalen Schutz vorsehe, die praktische Wirksamkeit nehmen.
In Fällen, in denen die mit einem Folgeantrag befasste zuständige nationale Behörde feststelle, dass die vom Antragsteller geltend gemachten Umstände von einer Missbrauchsabsicht und einer Absicht zeugen, das anwendbare Verfahren zu instrumentalisieren, so dass ihm die Anerkennung als Flüchtling auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie verweigert werden könne, bedeute der Ausdruck „unbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention“, dass der Antragsteller im betreffenden Mitgliedstaat trotzdem die durch die Genfer Flüchtlingskonvention gewährleisteten Rechte in Anspruch nehmen könne, falls die Behörde im Licht der genannten Umstände feststelle, dass der Antragsteller für den Fall der Rückkehr in sein Herkunftsland wahrscheinlich einer Verfolgung ausgesetzt wäre. Zu diesen Rechten zähle das durch Art. 33 Abs. 1 dieser Konvention gewährleistete Recht, wonach kein vertragschließender Staat einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen wird, in denen sein Leben oder seine Freiheit insbesondere wegen seiner Religion bedroht sein würde.
Der Gerichtshof hat zu seinem Urteil auch eine Pressemitteilung veröffentlicht.
-
Neues zu Eritrea
Das Oberverwaltungsgericht Koblenz trägt in seinem Urteil vom 24. Januar 2024 (Az. 13 A 10789/23.OVG) das ihm Mögliche bei, die bereits einigermaßen uneinheitliche und unübersichtliche asylgerichtliche Rechtsprechung zu Eritrea (siehe etwa zuletzt HRRF-Newsletter Nr. 111, Nr. 112 und Nr. 113) noch uneinheitlicher und unübersichtlicher zu gestalten, immerhin unter ausführlicher Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsgerichte.
Für die Rückkehrprognose will das Gericht auf eine frewillige Rückkehr nach Eritrea abstellen, weil einem aus dem Ausland zurückkehrenden Eritreer vorbehaltlich besonderer individueller Umstände die Zahlung der Aufbausteuer und die Abgabe der Reueerklärung zumutbar seien. Für Personen, die nicht im Verdacht exilpolitisch-oppositioneller Betätigung stünden, sei es dann nicht beachtlich wahrscheinlich, dass sie wegen illegaler Ausreise und/oder Entziehung vom Nationaldienst bestraft würden. Allerdings bestehe auch bei einer freiwilligen Rückkehr für aus dem Ausland zurückkehrende Eritreer im nationaldienstpflichtigen Alter, die den Nationaldienst noch nicht abgeleistet haben, nicht sonst davon befreit sind oder aufgrund besonderer Umstände direkt in den zivilen Teil des Nationaldienstes eingezogen werden, die beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass sie in den militärischen Teil des Nationaldienstes aufgeboten und dort einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung bis hin zur Folter ausgesetzt sein würden. Zudem bestehe eine beachtliche Wahrscheinlichkeit für die Annahme, dass dauerhaft aus dem Ausland zurückkehrende Eritreer auch bei Zahlung der Aufbausteuer und Unterzeichnung der Reueerklärung den sogenannten Diaspora-Status nicht erlangen könnten.
Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision in dem Verfahren gleich zweimal zugelassen. Zum einen wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache, weil in der Rechtsprechung umstritten sei, ob eritreischen Staatsangehörigen, denen nicht bereits aus anderen Gründen Schutz zu gewähren sei, grundsätzlich zugemutet werden könne, zur Vermeidung einer Bestrafung eine sogenannte „Reueerklärung“ abzugeben und ob daran anschließend bei der Rückkehrprognose im Rahmen der Prüfung subsidiären internationalen Schutzes auf eine freiwillige oder eine erzwungene Rückkehr abzustellen sei. Zum anderen als Tatsachenrevision gemäß § 78 Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 AsylG, weil das Gericht in der Beurteilung der tatsächlichen Möglichkeit permanenter Rückkehrer, den Diaspora-Status zu erlangen sowie der Frage des Bestehens einer beachtlichen Gefahr der Einziehung permanenter Rückkehrer in den militärischen Nationaldienst von der Beurteilung durch das Oberverwaltungsgericht Hamburg (Urteil vom 27. Oktober 2021, Az. 4 Bf 106/20.A) und das Oberverwaltungsgericht Greifswald (Urteil vom 17. August 2023, Az. 4 LB 145/20 OVG) abgewichen sei.
-
Untätigkeitsklage besser erst nach 15 Monaten
In einer Änderung ihrer bisherigen Rechtsprechung geht die 17. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf in ihrem Beschluss vom 19. Februar 2024 (Az. 17 K 7670/23.A) nunmehr davon aus, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über Asylanträge regelmäßig nicht mehr innerhalb von sechs Monaten entscheiden muss, sondern gemäß § 24 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 AsylG (erst) nach 15 Monaten, weil die Zahl der beim Bundesamt gestellten Asylanträge in den vergangenen Jahren stark gestiegen sei. Das hat für die Praxis vor allem zur Folge, dass Untätigkeitsklagen vor Ablauf dieser verlängerten Entscheidungsfrist besser nicht erhoben werden sollten, um nicht zu riskieren, gemäß §§ 75, 161 Abs. 3 VwGO auf den Kosten der Klage sitzenzubleiben.
-
Gemeindliche Obdachlosenunterbringung bei Familiennachzug
Der Verwaltungsgerichtshof München berichtet in einer Pressemitteilung vom 29. Februar 2024 über seinen noch nicht im Volltext vorliegenden Beschluss vom 15. Februar 2024 (Az. 4 CE 24.60), in dem er eine bayerische Gemeinde dazu verpflichtet hat, den im Wege des Familiennachzugs später nachgezogenen Familienangehörigen eines anerkannten Flüchtlings eine Obdachlosenunterkunft im Gemeindegebiet zuzuweisen. Die Gemeinde sei als örtliche Sicherheitsbehörde zur Unterbringung von unfreiwillig Obdachlosen in ihrem Gemeindegebiet verpflichtet; die Antragsteller hätten sich allein durch die Einreise nach Deutschland, ohne hier über eine Unterkunft zu verfügen, nicht freiwillig in die Obdachlosigkeit begeben, wenngleich dies möglicherweise vorhersehbar gewesen sei. Dass der Bundesgesetzgeber im vorliegenden Fall den Familiennachzug trotz fehlenden Wohnraums gestattet und so vielleicht eine Ursache für die Obdachlosigkeit gesetzt habe, entbinde die Gemeinde nicht von ihrer Aufgabe.
-
Vermischtes vom Bundesverwaltungsgericht
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 22. Januar 2024 (Az. 1 C 15.23) eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bremen vom 30. August 2023 (Az. 2 LC 116/23) zurückgewiesen. Die Revision hatte Klärungsbedarf zur Auslegung der in § 25 Abs. 3 AufenthG enthaltenen Ausschlussgründe für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen geltend gemacht, das Bundesverwaltungsgericht hielt die aufgeworfenen Fragen für bereits höchstrichterlich geklärt.
In seinem Beschluss vom 18. Januar 2024 (Az. 1 B 49.23) hat das Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 11. September 2023 (Az. 11 A 1/22.A) wegen Nichterfüllung der Darlegungsanforderungen verworfen; in dem Verfahren ging es um die Länge der Klagefrist in Fällen, in denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Stellung eines Folgeantrags die Durchführung eines weiteren Asylverfahrens ablehnt und keine erneute Abschiebungsandrohung erlässt (siehe dazu ausführlich HRRF-Newsletter Nr. 114).
-
CDU/CSU-Fraktion entdeckt Dublin-Statistiken
Nun ist es also soweit: Auch die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag hat das Instrument der Kleinen Anfrage entdeckt, um von der Bundesregierung ergänzende Informationen zur Asylstatistik zu erfragen. In einer aktuellen Kleinen Anfrage (BT-Drs. 20/10495 vom 27. Februar 2024) stellt die Fraktion insgesamt 31 Fragen zu Dublin-Verfahren und „sonstiger Sekundärmigration“. Die Lücke bei Dublin-Statistiken, die durch den Zerfall der Linksfraktion entstehen dürfte, weil die neue Gruppe Die Linke im Deutschen Bundestag pro Kalendermonat nur noch zehn Große oder Kleine Anfragen stellen darf, wird die CDU/CSU-Fraktion in Anbetracht der Formulierung der von ihr gestellten Fragen nicht schließen können.
-
Das schreiben die Anderen
Im Verfassungsblog ist asylpolitische Woche, es geht dort um die Kriminalisierung der Unterstützung von Schutzsuchenden (No Benefit und Pushing Back), das britische Ruanda-Modell (Abschreckung um jeden Preis?), den Vorwurf an die EU, Schutzsuchende an den Außengrenzen ihrer Rechte gezielt zu berauben (How the EU Death Machine Works), die Sichtweise auf Schutzsuchende an der östlichen EU-Außengrenze als primär gefahrenabwehrrechtliches Problem (The EU’s Eastern Border and Inconvenient Truths), eine Einführung in das europäische Grenzmanagement (Understanding European Border Management), das (fehlende) Recht von Schutzsuchenden auf Freizügigkeit (Asylum-Seekers’ Right to Free Movement), die Folgen der GEAS-Reform für „Rechtskämpfe“ zur Durchsetzung der Rechte von Schutzsuchenden (The Future of Legal Struggles), die Grenzen für Verträge mit sicheren Drittstaaten (When Treaties are Forbidden) und die Externalisierung von Humanität (Humanitarian Externalisation).
Die Kommentarfunktion findet sich bei den einzelnen Beiträgen: Einfach auf die Überschrift klicken, um zum jeweiligen Beitrag zu gelangen.
Neu im Blog
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026
Indiz- und Bindungswirkung vorläufiger Maßnahmen des UN-Sozialauschusses?
20. Januar 2026
Im Oktober 2025 hat der UN-Sozialausschuss in einer Eilentscheidung entschieden, dass Deutschland einer vom Leistungsausschluss in Dublin-Fällen betroffenen Person existenzsichernde Leistungen gewähren muss. Dieser Beitrag analysiert die Entscheidung und beantwortet die Frage, ob ihr eine Indiz- und Bindungswirkung zukommt …
Dublin und die Drittstaaten
1. Januar 2026