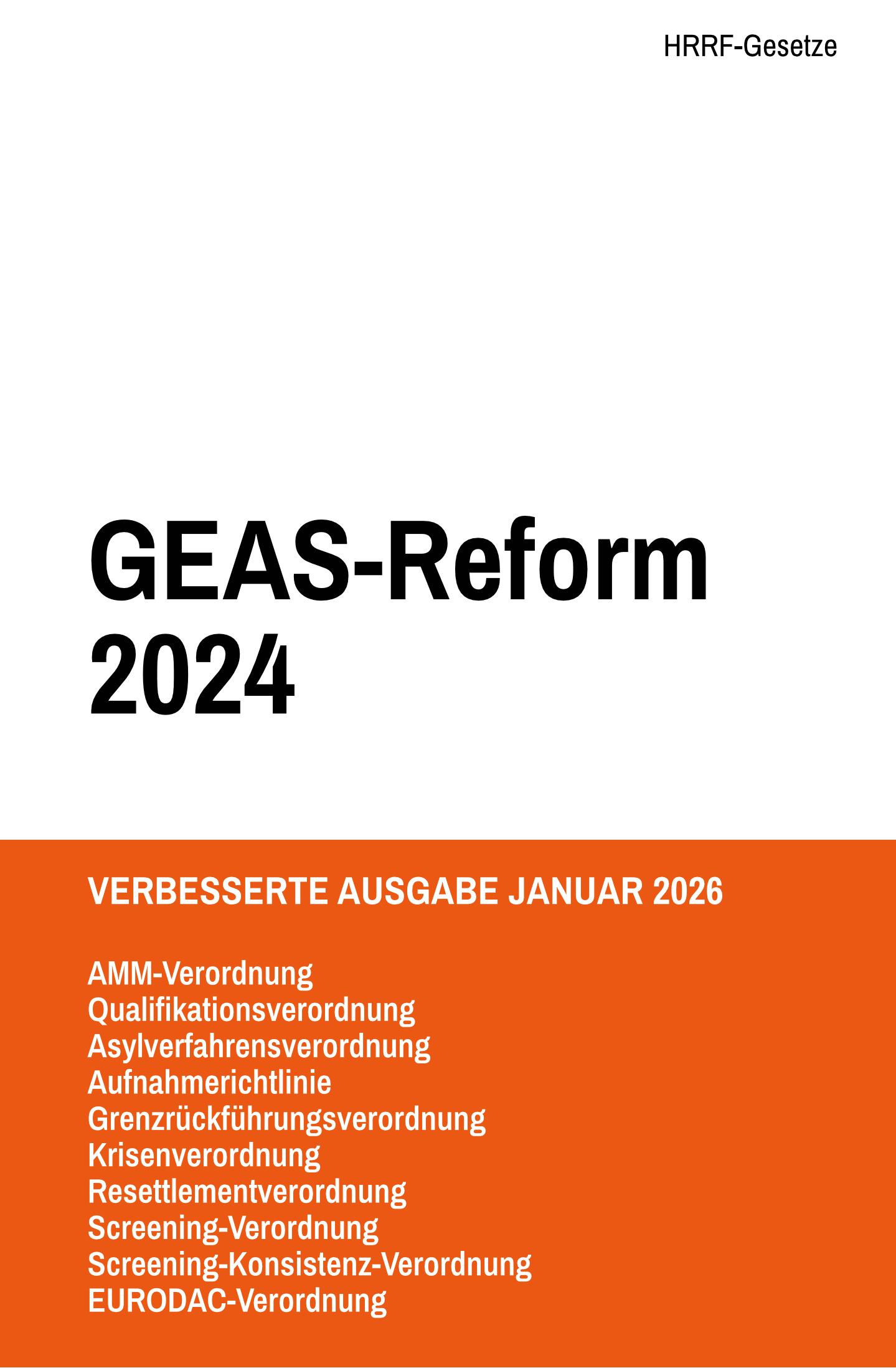Der Europäische Gerichtshof findet Pushbacks an den EU-Außengrenzen zwar auch nicht gut, meint aber, dass eine Pushback-Praxis Dublin-Überstellungen nicht grundsätzlich verhindern muss. Familienflüchtlingsschutz soll es auch ohne Bestand der Ehe im Herkunftsstaat geben können, eine versehentliche Ausreise den Chancen-Aufenthalt verhindern können und ein bloßer Duldungsanspruch für den Chancen-Aufenthalt nicht ausreichend sein. Immerhin soll die drohende Verschlimmerung einer chronischen psychischen Erkrankung „akut“ im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes sein können. Ach ja, und das Rückführungsverbesserungsgesetz ist auch bereits bei den Gerichten angekommen.
Ausgabe
•
Doppelte Deckung
-
Dublin-Überstellungen können trotz Pushbacks zulässig sein
Praktiken der pauschalen Zurückschiebung oder Zurückweisung und der Inhaftnahme an Grenzübergangsstellen in einem EU-Mitgliedstaat bedeuten nicht zwangsläufig, dass in diesem Staat systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 der Dublin‑III‑Verordnung vorliegen, die eine Dublin-Überstellung verhindern würden, meint der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 29. Februar 2024 (Rs. C-392/22), und zwar auch dann nicht, wenn diese Praktiken mit dem Unionsrecht unvereinbar sind und gravierende Schwachstellen im Asylverfahren und in den Aufnahmebedingungen für Schutzsuchende darstellen.
Die Entscheidung ist Wasser auf die Mühlen der Anhängerinnen und Anhänger einer „künstlichen“ (so noch das Verwaltungsgericht Braunschweig in seinem Urteil vom 8. Mai 2023, Az. 2 A 269/22) Differenzierung zwischen der Gruppe aller Schutzsuchender und der Gruppe (nur) der Dublin-Rückkehrerinnen und -Rückkehrer. In dem vom EuGH entschiedenen Verfahren ging es um einen syrischen Schutzsuchenden, der von Belarus kommend im November 2021 nach Polen eingereist war und dort internationalen Schutz beantragt hatte. Er hatte vorgebracht, nach seiner Einreise in polnisches Hoheitsgebiet zunächst dreimal im Wege eines Pushbacks nach Belarus zurückgeschoben und sodann nach letztlich erfolgreicher Äußerung eines Asylgesuchs eine Woche lang in einem polnischen Grenzschutzzentrum festgehalten worden zu sein, bevor er innerhalb der EU weiterreisen und schließlich in den Niederlanden einen erneuten Asylantrag stellen konnte.
Der EuGH äußerte dazu, dass bei der rechtlichen Beurteilung von Dublin-Überstellungen nur solche Schwachstellen in EU-Mitgliedstaaten relevant seien, die gerade „systemische Schwachstellen“ seien und die im Einzelfall die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung mit sich brächten. In dem entschiedenen Verfahren hätten die niederländischen Gerichte zu prüfen, ob die festgestellten Schwachstellen in Polen immer noch vorhanden seien und ob sie allgemein das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen beträfen, die für Personen gelten, die internationalen Schutz beantragt hätten, oder zumindest für bestimmte Personen, die internationalen Schutz beantragen, wie beispielsweise die Gruppe von Personen, die internationalen Schutz suchten, nachdem sie die Grenze zwischen Polen und Belarus überschritten hätten oder diese Grenze zu überschreiten versucht hätten. Sollte sich herausstellen, dass dies der Fall sei, könnten diese Mängel im Hinblick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs, nach der bestimmte Personengruppen betreffende Schwachstellen systemischen Schwachstellen gleichgesetzt werden können, als „systemisch“ eingestuft werden.
Wenn solche systemischen Schwachstellen vorliegen, müsse es außerdem zum einen ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme geben, dass der Kläger des Ausgangsverfahrens im Fall einer Überstellung tatsächlich Gefahr liefe, erneut an die Grenze zwischen Polen und Belarus verbracht und dort, gegebenenfalls nach einer Inhaftnahme an einer Grenzübergangsstelle, im Wege eines Pushbacks nach Belarus zurückgeschoben zu werden, und zum anderen, ob solche Maßnahmen oder Praktiken ihn einer Situation extremer materieller Not aussetzen würden. Bei dieser Beurteilung sei die Situation zu berücksichtigen, in der sich der betreffende Antragsteller bei der Überstellung oder nach der Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat zu befinden drohe, und nicht diejenige, in der er sich befand, als er ursprünglich in das Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats einreiste.
Der Mitgliedstaat, der einen Schutzsuchenden überstellen wolle, müsse zum einen alle Informationen berücksichtigen, die ihm dieser Schutzsuchende vorlege, und müsse zum anderen bei der Ermittlung der Tatsachen mitwirken, indem er das Vorliegen von Gefahren im zuständigen Mitgliedstaat auf der Grundlage objektiver, zuverlässiger, genauer und gebührend aktualisierter Angaben und im Hinblick auf den durch das Unionsrecht verbürgten Schutzstandard für die Grundrechte würdige. Er müssen außerdem gegebenenfalls von sich aus sachdienliche Informationen zu etwaigen systemischen Schwachstellen im Asylverfahren und in den Aufnahmebedingungen im zuständigen Mitgliedstaat berücksichtigen, die ihm nicht unbekannt sein könnten. Bevor er zu dem Schluss komme, dass im Fall einer Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat eine tatsächliche Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung bestehe, könne sich der Mitgliedstaat jedoch um individuelle Garantien bemühen, wenn diese glaubhaft seien und ausreichten, um die tatsächliche Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung auszuschließen.
Der EuGH hatte bereits in seinem Urteil vom 30. November 2023 (Rs. C-228/21 u.a.) eine gewisse Relativierung seiner früheren Rechtsprechung vorgenommen, indem er entschied, dass ein die Überstellung von Schutzsuchenden beabsichtigender Mitgliedstaat eine möglicherweise im zuständigen Mitgliedstaat bestehende Gefahr einer Verletzung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung erst dann prüfen dürfe, wenn er zuvor festgestellt habe, dass in dem zuständigen Mitgliedstaat systemische (und gerade nicht nur im Einzelfall bestehende) Schwächen bestünden.
-
Rückführungsverbesserungsgesetz beeinflusst anhängige Beschwerden nicht
In Hinblick auf das am 27. Februar 2024 in Kraft getretene Rückführungsverbesserungsgesetz führt der Verwaltungsgerichtshof Mannheim in seinem Beschluss vom selben Tag (Az. 11 S 276/24) aus, dass der nun in § 80 AsylG ausdrücklich angeordnete Ausschluss der Beschwerde gegen Entscheidungen über Maßnahmen zum Vollzug einer Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung nicht für Beschwerden gilt, die am 27. Februar 2024 bereits gerichtlich anhängig waren oder die noch gegen verwaltungsgerichtliche Beschlüsse erhoben werden können, die vor dem 27. Februar 2024 zugestellt wurden. Der im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Schutz des Vertrauens eines Rechtsmittelführers in die nach Maßgabe der Grundsätze des intertemporalen Prozessrechts gewährleistete Rechtsmittelsicherheit gebiete, dass bei einem gesetzlich festgelegten Rechtsmittelausschluss ein bereits eingelegtes oder ursprünglich noch zulässiges Rechtsmittel zulässig bleibe, sofern das Gesetz nicht mit hinreichender Deutlichkeit etwas Abweichendes bestimme. Das Rückführungsverbesserungsgesetz enthalte keine solche intertemporale Regelung.
-
Familienschutz auch ohne Ehe im Herkunftsstaat
Mit einer so ungewöhnlichen wie reizvollen Interpretation der Voraussetzungen des Familienschutzes für Ehegatten wartet das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 9. Februar 2024 (Az. 38 K 86/20 A) auf. Familienschutz für Ehegatten gemäß § 26 AsylG setzt an sich voraus, dass die Ehe mit dem Stammberechtigten schon in dem Staat bestanden hat, in dem der Stammberechtigte „verfolgt wird“ bzw. in dem ein ernsthafter Schaden droht.
Familienschutz sei aber, so das Verwaltungsgericht, akzessorisch zum internationalen Schutz des stammberechtigten Familienmitglieds, für das Voraussetzung für eine Schutzgewähr wiederum nicht nur die im Herkunftsstaat drohende Verfolgung bzw. der dort drohende ernsthafte Schaden sei, sondern gemäß § 27 AsylG auch, dass das stammberechtigte Familienmitglied keine anderweitige Sicherheit vor Verfolgung bzw. vor dem drohenden ernsthaften Schaden in einem anderen Staat gefunden habe. Diese „Staaten der fehlenden Sicherheit“ müssten aufgrund der Akzessorietät des Familienschutzes mit in § 26 AsylG hineingelesen werden; dem Ehegatten eines Schutzberechtigten sei daher die Flüchtlingseigenschaft auch dann zuzuerkennen, wenn die Ehe mit dem Schutzberechtigten (nur) in dem Staat bestanden habe, in dem der Schutzberechtigte sich aufgehalten habe, ohne dort gemäß § 27 AsylG Sicherheit vor Verfolgung gefunden zu haben.
Eingekleidet war das Verfahren übrigens in eine etwas unübersichtliche Konstellation, in der das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der Klägerin zunächst irrtümlich Flüchtlingsschutz aus eigenem Recht zuerkannt hatte, weil es davon ausgegangen war, dass sie aus einem anderen Staat als von ihr angegeben stammte. Ein Widerruf dieser Anerkennung scheide im Prinzip aus, so das Verwaltungsgericht, weil § 73 AsylG einen Widerruf nicht ermögliche, wenn wie hier ein bloßer Behördenfehler die irrtümliche Anerkennung verschuldet habe. Im entschiedenen Verfahren lag dann zwar an sich der besondere Widerrufsgrund des § 73 Abs. 5 AsylG vor, weil die Klägerin unter dem Schutz der UNRWA stand, allerdings sei die Aufhebungsentscheidung des Bundesamts im Ergebnis doch rechtswidrig gewesen, nämlich wegen des in § 73 Abs. 4 Hs. 2 AsylG klarstellend zum Ausdruck gebrachten „Grundsatzes der doppelten Deckung“, eben weil die Klägerin einen Anspruch auf Zuerkennung von Familienflüchtlingsschutz habe.
-
Kein Chancen-Aufenthalt bei sehr kurzer Aufenthaltsunterbrechung
Eine auch nur kurzzeitige Ausreise aus dem Bundesgebiet im Duldungsstatus hat das Erlöschen der Duldung zur Folge und führt zu einer Unterbrechung der Voraufenthaltszeit des § 104c Abs 1 S 1 AufenthG, so dass dessen Voraussetzungen nicht vorliegen, sagt das Verwaltungsgericht Sigmaringen in seinem Beschluss vom 26. Februar 2024 (Az. 1 K 344/24). Die in Rechtsprechung und Literatur einhellig vertretene Auffassung, dass bei § 25b AufenthG kurzfristige Unterbrechungen des Aufenthalts unschädlich seien, könne auf das Chancen-Aufenthaltsrecht des § 104c AufenthG aufgrund der grundlegend anderen Normsystematik und des eindeutigen Wortlautes nicht übertragen werden.
Vielmehr sei für die Frage, ob eine kurzzeitige Ausreise auch von nur wenigen Stunden eine Unterbrechung des Voraufenthalts im Sinne des § 104c AufenthG darstelle, zwischen den verschiedenen Aufenthaltsstatus der Duldung und der Aufenthaltserlaubnis zu differenzieren, weil die Aufenthaltserlaubnis und die Duldung sich unterschiedlich verhielten, wenn ihr Inhaber ausreise. Sofern die BMI-Anwendungshinweise kurzfristige Unterbrechungen des Aufenthalts im Bundesgebiet für unschädlich hielten, beziehe sich das nur auf den physischen Aufenthalt, nicht jedoch auf das Erfordernis des ununterbrochenen Besitzes u.a. einer Duldung, die jedoch wie der Duldungsanspruch gemäß § 60a Abs. 5 S. 1 AufenthG mit der physischen Ausreise erlösche, auch wenn diese lediglich versehentlich erfolge, und bei einer anschließenden Wiedereinreise nicht wieder auflebe. Insofern müssten betroffene Duldungsinhaber „in Grenzgebieten besondere Vorsicht walten lassen“.
Im entschiedenen Verfahren war der Kläger im Bahnhof von Kehl (Baden-Württemberg) aus Versehen in einen Nahverkehrszug nach Straßburg (Frankreich) eingestiegen und sodann mit dem nächsten Zug nach Deutschland zurückgekehrt; dabei wurde er von der Bundespolizei kontrolliert.
-
Bloßer Duldungsanspruch reicht für Chancen-Aufenthalt nicht
Das Oberverwaltungsgericht Greifswald geht in seinem Beschluss vom 8. Januar 2024 (Az. 2 O 559/23 OVG) davon aus, dass für die Erfüllung der Voraufenthaltsfrist des § 104c Absatz 1 Satz 1 AufenthG ein bloßer Anspruch auf Erteilung einer Duldung nicht ausreicht, da der Wortlaut der Norm darauf abstelle, dass sich der Ausländer „geduldet“ im Bundesgebiet aufgehalten haben müsse. Das setze die Erteilung einer Duldung voraus, also die Entscheidung der Ausländerbehörde, die Abschiebung des Ausländers auszusetzen. Es sei zweifelhaft, ob § 104c Absatz 1 Satz 1 AufenthG lediglich auf einen Duldungsanspruch abstelle, weil dies erfordern würde, nachträglich im Verfahren über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für gegebenenfalls mehrere Jahre zurückliegende Zeiträume zu klären, ob in der Vergangenheit unter irgendeinem Gesichtspunkt ein Duldungsanspruch bestanden habe. Dafür, dass dies vom Gesetzgeber gewollt war, lasse sich weder dem Wortlaut des Gesetzes noch den Gesetzgebungsmaterialien etwas entnehmen. Die Argumentation mit dem Schweigen des Gesetzgebers ist übrigens zumindest zweischneidig, weil sich dem Wortlaut und den Gesetzgebungsmaterialien ja auch nicht entnehmen lässst, dass der Gesetzgeber das nicht gewollt hat.
-
Kostenerstattung für stationäre psychiatrische Behandlung eines Schutzsuchenden
In seinem Urteil vom 29. Februar 2024 (Az. B 8 AY 3/23 R), über den es in einem Terminbericht und in einer Pressemitteilung berichtet, hat das Bundessozialgericht die Revision des Landkreises Hildesheim gegen die Verurteilung zur Übernahme der Kosten für eine vierwöchige stationäre psychiatrische Behandlung eines Schutzsuchenden zurückgewiesen. Der Kläger hatte sich nach einem Suizidversuch seines Mitbewohners im gemeinsamen Zimmer der Flüchtlingsunterkunft in einem Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge vorgestellt, an einer ambulanten Stabilisierungsgruppe aber nicht teilgenommen, nachdem der beklagte Landkreis seinen Antrag auf Übernahme der Fahrkosten dorthin abgelehnt hatte.
Die Würdigung des Landessozialgerichts, dass die stationäre Behandlung des Klägers wegen des Verdachts auf eine schwere depressive Episode und eine posttraumatische Belastungsstörung als Notfall notwendig gewesen sei, um den Eintritt eines kritischen Stadiums der Erkrankung zu verhindern und eine Eigengefährdung auszuschließen, sei nicht zu beanstanden, meinte das Bundessozialgericht. „Akut“ im Sinne von § 4 Abs. 1 AsylbLG könne auch die Verschlimmerung einer bestehenden, gegebenenfalls chronischen Erkrankung sein, wenn die Behandlung wie hier aus medizinischen Gründen unaufschiebbar sei. Die Behandlung sei auch bei einem perspektivisch nur vorübergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlich gewesen und habe in dieser Zeit des Aufenthalts auch abgeschlossen werden können. Nichts anderes hätte gegolten, wenn die Therapie zwar dauerhaft erforderlich gewesen, aber zur Abwendung einer unumkehrbaren oder akuten Verschlechterung in der Zeit des Aufenthalts im Bundesgebiet notwendig geblieben wäre.
-
Nordrhein-westfälische Statistiken
Das Oberverwaltungsgericht Münster informiert in einer Pressemitteilung vom 4. März 2024 unter anderem darüber, dass die Zahl der Asylverfahren bei den sieben Verwaltungsgerichten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2023 erneut gestiegen ist und mit rund 20.600 neuen Streitfällen im Jahr 2023 erstmals seit 2019 (damals 22.700) wieder über 20.000 liegt. Damit sei auch der Anteil der Asylsachen an allen neu eingegangenen Verfahren bei den sieben Verwaltungsgerichten erheblich angewachsen, nämlich auf durchschnittlich rund 40% aller Verfahren, wobei die Quote am Verwaltungsgericht Köln mit etwa 24% am niedrigsten und am Verwaltungsgericht Aachen mit rund 56% am höchsten sei. Die Verwaltungsgerichte hätten über rund 53% der Asylklagen innerhalb eines Jahres entschieden.
In einer weiteren Pressemitteilung vom 28. Februar 2024 berichtet das Verwaltungsgericht Münster über seine Tätigkeit im Jahr 2023 unter anderem in asylrechtlichen Verfahren. Die durchschnittliche Dauer von asylrechtlichen Hauptsacheverfahren beim Gericht habe sich von 17,4 Monaten im Vorjahr 2022 auf 16,7 Monate verkürzt und asylrechtliche Eilverfahren hätten wie im Vorjahr durchschnittlich zwei Wochen gedauert. Im Jahr 2023 seien beim Gericht insgesamt 2.055 neue asylrechtliche Klagen und Eilanträge eingegangen, das sei etwas weniger als im Vorjahr 2022 (2.196 Eingänge). Der Anteil der Asylverfahren an der Gesamtzahl der Verfahren des Gerichts liege bei annähernd 50%.
Diese nordrhein-westfälige PR-Offensive scheint zumindest auch zum Ziel zu haben, bei der Landespolitik ein gewisses Bewusstsein für den Personalbedarf der örtlichen Justiz zu schaffen: Die von der Politik angestrebte weitere und umfassende Verkürzung der Laufzeiten von Asylverfahren erfordere ausreichendes Personal an den Gerichten, damit nicht die Bearbeitung anderer, für die Beteiligten und oftmals auch für die Allgemeinheit nicht weniger wichtiger Verfahren zurückgestellt werden müsse. Es sei daher zu hoffen, dass die Haushaltsgesetzgebung des Landes dem Beschluss des Bundeskanzlers und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 6. November 2023 Rechnung trage, wonach Asylgerichtsverfahren für Angehörige von Staaten, für die die Anerkennungsquote weniger als 5 % beträgt, in drei Monaten, und in allen anderen Fällen regelhaft nach sechs Monaten abgeschlossen sein sollen.
-
HRRF-Monatsübersicht für Februar 2024 verfügbar
Die HRRF-Monatsübersicht für Februar 2024 ist zum Download verfügbar und bietet auf acht Seiten eine praktische Zusammenfassung aller im Monat Februar 2024 im HRRF-Newsletter vorgestellten Entscheidungen.
Die Kommentarfunktion findet sich bei den einzelnen Beiträgen: Einfach auf die Überschrift klicken, um zum jeweiligen Beitrag zu gelangen.
Neu im Blog
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026
Indiz- und Bindungswirkung vorläufiger Maßnahmen des UN-Sozialauschusses?
20. Januar 2026
Im Oktober 2025 hat der UN-Sozialausschuss in einer Eilentscheidung entschieden, dass Deutschland einer vom Leistungsausschluss in Dublin-Fällen betroffenen Person existenzsichernde Leistungen gewähren muss. Dieser Beitrag analysiert die Entscheidung und beantwortet die Frage, ob ihr eine Indiz- und Bindungswirkung zukommt …
Dublin und die Drittstaaten
1. Januar 2026