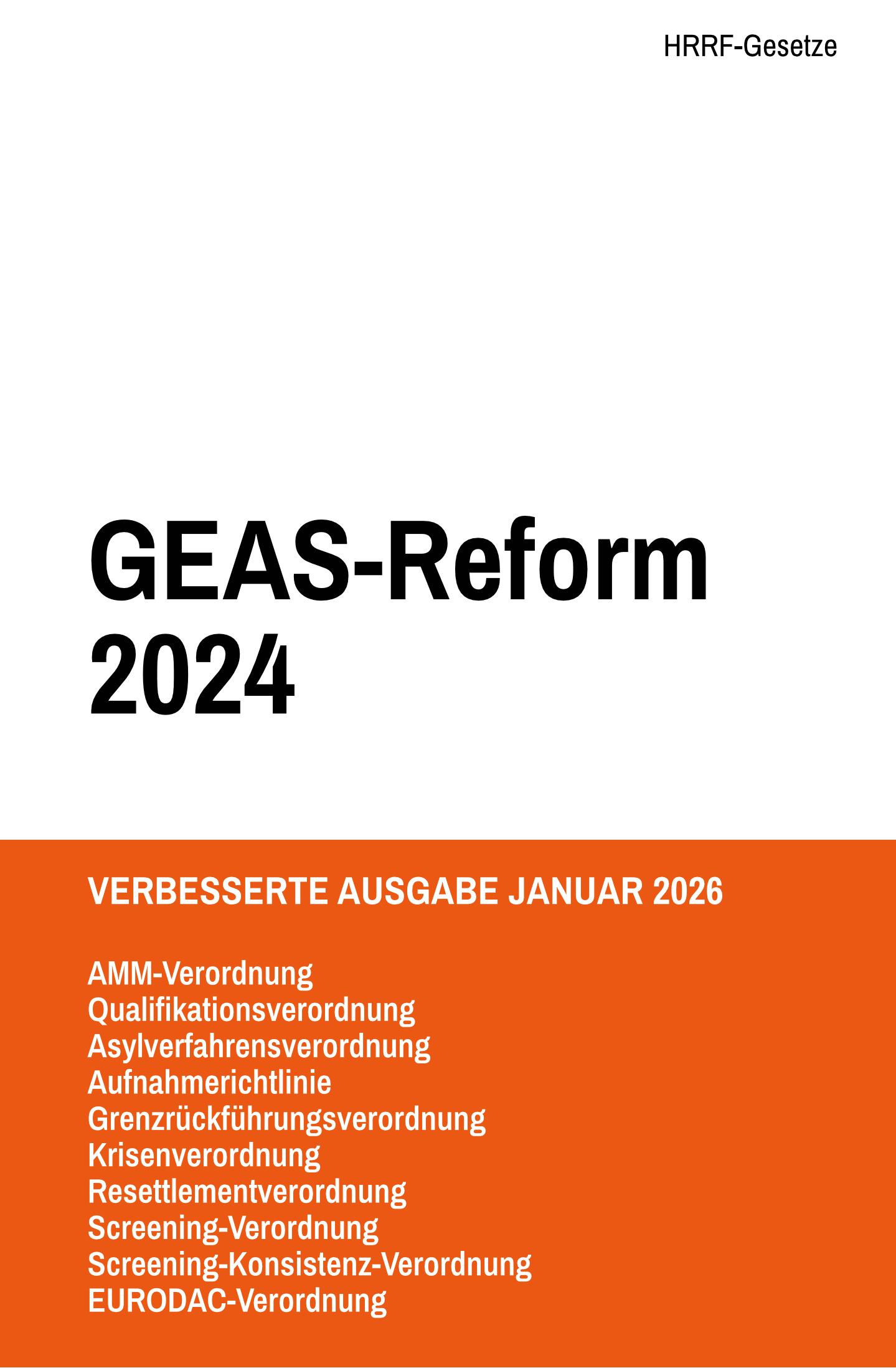Eine Klage gegen das EU-Türkei-Abkommen von 2016, ein Freispruch für Überlebende des Pylos-Schiffsunglücks und eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Ausweisung eines faktischen Inländers sind in dieser Woche ebenso Themen wie eine erfolglose Landesverfassungsbeschwerde gegen Verfahrensmängel in einem Asylverfahren und wie die Ansicht, dass es in Ungarn keine systemischen Mängel im Asylsystem und bei Aufnahmebedingungen gebe. Außerdem geht es erneut um die Auslegung des Rückführungsverbesserungsgesetzes, nämlich in Hinblick auf die Ablehnung von Asylanträgen als offensichtlich unbegründet und beim Rechtsschutz gegen abgelehnte Folgeanträge. Ach ja, und Griechenland ist auch mal wieder vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt worden.
Ausgabe
•
Genügende Argumentationstiefe
-
Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen Ausweisung eines faktischen Inländers
Das Bundesverfassungsgericht hält in seinem Beschluss vom 18. April 2024 (Az. 2 BvR 29/24) eine Verfassungsbeschwerde für offensichtlich begründet, die gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs München vom 18. Dezember 2023 (Az. 10 ZB 23.1200) erhoben wurde. In dem Verfahren hatten die Vorinstanzen eine Ausweisung des Beschwerdeführers wegen Gewaltstraftaten und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln für rechtmäßig gehalten. Das, so das BVerfG, habe die verfassungsrechtliche Pflicht der Gerichte aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzt, alle für die Abwägung in Ausweisungssachen wesentlichen Umstände zu erkennen, zu ermitteln und diese mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Die konkrete Würdigung der vom Beschwerdeführer vorgetragenen Umstände zu seiner Verwurzelung in Deutschland und der Entwurzelung hinsichtlich des Kosovo entspreche nicht den verfassungsrechtlich gebotenen Maßstäben, insbesondere der Notwendigkeit, die aktuelle Entwicklung seit der Aussetzung von Unterbringung und Reststrafe mit besonderer Sorgfalt auszuwerten und zu berücksichtigen. Es sei bereits zweifelhaft, ob der Verwaltungsgerichtshof das Bestehen einer ernsthaften Wiederholungsgefahr in einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügenden Argumentationstiefe begründet habe, auch fehle es an einer ernsthaften Berücksichtigung des Umstands, dass der Beschwerdeführer in München geboren und aufgewachsen sei, dort die mittlere Reife erlangt habe und sein Leben ausschließlich legal im Bundesgebiet geführt habe, wo auch wesentliche Teile seiner Familie und sein sonstiges soziales Umfeld lebten. Auch das Verwaltungsgericht habe den Status des Beschwerdeführers als faktischen Inländer im Rahmen der Abwägung der Bleibe- und Ausweisungsinteressen lediglich bagatellisierend erwähnt.
-
Überlebende des Pylos-Unglücks freigesprochen
Ein Gericht auf der griechischen Insel Kalamata hat Medienberichten zufolge (siehe etwa hier und hier) die Strafverfahren gegen neun Überlebende (die „Pylos 9“) des Pylos-Unglücks im Juni 2023 eingestellt und die Angeklagten freigesprochen. Das Schiffsunglück, bei dem über 600 Menschen ums Leben kamen, hatte sich in internationalen Gewässern ereignet, die neun Überlebenden, die über elf Monate in Untersuchungshaft verbrachten, waren wegen des Herbeiführen eines Schiffsunglücks, wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, wegen Menschenhandels und der Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt. In Hinblick auf die Tatbestände des Herbeiführen eines Schiffsunglücks und wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verneinte das Gericht einem Medienbericht zufolge die Zuständigkeit griechischer Gerichte, die Tatbestände des Menschenhandels und der Beihilfe zur illegalen Einreise sah es als nicht erfüllt an. Strafrechtliche Ermittlungen gegen die griechische Küstenwache laufen derweil noch, der vorgeworfen wird, für das Unglück mitverantwortlich zu sein.
-
Klage gegen EU-Türkei-Abkommen eingereicht
Mehrere Nichtregierungsorganisationen, darunter die niederländische Sektion von Amnesty International, haben den niederländischen Staat im April 2024 wegen seiner Mitwirkung am Abschluss und an der Aufrechterhaltung des EU-Türkei-Abkommens von 2016 verklagt. In dem Abkommen wurde vereinbart, dass Asylsuchende, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln in der Ägäis gelangen, wieder in die Türkei abgeschoben werden sollen, und gleichzeitig für jeden von den griechischen Inseln in die Türkei rückgeführten syrischen Flüchtling ein anderer syrischer Flüchtling aus der Türkei in der EU neu angesiedelt wird. Der niederländische Staat sei für die menschenrechtswidrige Behandlung von Schutzsuchenden auf den griechischen Inseln unter anderem deswegen mitverantwortlich, weil die Niederlande zum Zeitpunkt des Abschlusses des EU-Türkei-Abkommens den EU-Ratsvorsitz innegehabt hätten und sich als „Architekt“ des Abkommens betrachteten, ihr die schwerwiegenden Mängel im griechischen Asyl- und Aufnahmesystem bewusst gewesen seien und sie in dem Wissen gehandelt hätten, dass es klare Hinweise darauf gab, dass die Türkei beim Abschluss des Abkommens die Anforderungen der EU selbst an sichere Drittländer nicht erfüllen würde. Die Erfolgsaussichten der Klage werden derweil eher skeptisch beurteilt.
-
Keine systemischen Schwachstellen in Ungarn
In Ungarn lassen sich keine systemischen Schwachstellen des Asylsystems und der Aufnahmebedingungen während des Asylverfahrens und im Falle der Zuerkennung internationalen Schutzes für gesunde, arbeitsfähige Personen feststellen, meint das Verwaltungsgericht Düsseldorf in seinem Beschluss vom 15. Mai 2024 (Az. 22 L 764/24.A). Trotz des weiterhin geltenden sogenannten „Botschaftsverfahrens“, wonach ein Schutzgesuch in Ungarn erst nach der Abgabe einer „Absichtserklärung“ bei der ungarischen Botschaft in Belgrad/Serbien oder Kiew/Ukraine gestellt werden darf und das der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 22. Juni 2023 (Rs. C-823/21) für europarechtswidrig erklärt habe, bestehe für Dublin-Rückkehrer die realistische Möglichkeit, den in einem anderen Mitgliedstaat gestellten Asylantrag zur Durchführung eines Asylverfahrens in Ungarn aufrechtzuerhalten. Personen, die in Ungarn noch keinen Asylantrag gestellt hätten und im Rahmen des Dublin-Verfahrens zurückgeführt würden, müssten bei ihrer Ankunft erklären, ob sie beabsichtigen, ihren im überstellenden Land gestellten Asylantrag aufrechtzuerhalten. Sei dies der Fall, werde das Asylverfahren eingeleitet.
-
Neues zu den neuen Folgeanträgen
Das Verwaltungsgericht Hamburg geht in seinem Beschluss vom 8. Mai 2024 (Az. 12 AE 1859/24) davon aus, dass seit Inkrafttreten des Rückkehrverbesserungsgesetzes vom 21. Februar 2024 gemäß § 71 Abs. 5 Satz 3 AsylG n.F. für Eilrechtsschutz gegen eine Ablehnung eines Asylfolgeantrags als unzulässig auch bei unterbliebener erneuter Abschiebungsandrohung ein Antrag (nur) nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage statthaft ist. Außerdem finde § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylG n.F. auf einen Asylantrag, den ein Ausländer nach bestandskräftiger Ablehnung seines vorangegangenen Asylantrags nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG stelle (sog. „Anerkannten-Folgeantrag“), keine Anwendung. Unter die unanfechtbare Ablehnung eines früheren Asylantrags im Sinne dieser Vorschrift fielen bei unionsrechtskonformer Auslegung nur solche Entscheidungen, denen eine inhaltliche Prüfung und Ablehnung der Asylgründe zugrunde liege. Eine Unzulässigkeitsentscheidung nach § 29 Abs. 1 Nr. 5 AsylG schließlich dürfte grundsätzlich nicht als Unzulässigkeitsentscheidung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG oder als ablehnende Entscheidung über ein Wiederaufgreifen des ersten Asylverfahrens nach § 51 VwVfG aufrechterhalten oder in eine solche Entscheidung umgedeutet werden können.
-
Neues zu offensichtlich unbegründeten Asylanträgen
Mit der Neufassung von § 30 AsylG durch das Rückführungsverbesserungsgesetz beschäftigen sich sowohl das Verwaltungsgericht Wiesbaden (Beschluss vom 23. April 2024, Az. 4 L 353/24.WI.A) als auch das Verwaltungsgericht Hamburg (Beschluss vom 14. Mai 2024, Az. 5 AE 1954/24). § 30 AsylG regelt, wann unbegründete Asylanträge als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden dürfen.
§ 30 Abs. 1 Nr. 2 AsylG, so das Verwaltungsgericht Hamburg, sei dahingehend zu verstehen, dass dieser drei Tatbestandsvarianten enthalte und demnach eine Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet nach dieser Vorschrift (nur) in Betracht komme, wenn der Ausländer entweder (1.) eindeutig unstimmige und widersprüchliche, (2.) eindeutig falsche oder (3.) offensichtlich unwahrscheinliche Angaben, die im Widerspruch zu hinreichend gesicherten Herkunftslandinformationen stehen, gemacht habe. Dabei beziehe sich das Erfordernis des Widerspruchs zu hinreichend gesicherten Herkunftslandinformationen nur auf die dritte Tatbestandsvariante der offensichtlich unwahrscheinlichen Angaben. Ein Vortrag im Asylverfahren, der als gänzlich oberflächlich und pauschal zu bewerten sei und dem trotz entsprechender Nachfragen keinerlei Einzelheiten oder nachvollziehbare Erklärungen im Hinblick auf das vorgebrachte Verfolgungsschicksal zu entnehmen seien, könne als offensichtlich unwahrscheinlich angesehen werden. Komme der Widerspruch zu hinreichend gesicherten Herkunftslandinformationen hinzu, vermöge dies die Offensichtlichkeitsentscheidung nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 AsylG rechtfertigen.
Dabei, so das Verwaltungsgericht Wiesbaden, gebe es keine erheblichen rechtlichen Bedenken gegen einen „Austausch“ der Offensichtlichkeitsgründe der Nummern 1 (Vorbringen lediglich belangloser Umstände) und 2 (eindeutig unstimmige und widersprüchliche, eindeutig falsche oder offensichtlich unwahrscheinliche Angaben) des § 30 Abs. 1 AsylG. Bei der Anwendung von § 30 Abs. 2 AsylG, wonach die Ablehnung eines Asylantrags eines unbegleiteten Minderjährigen als offensichtlich unbegründet nur eingeschränkt möglich ist, sei für die Beurteilung der Minderjährigkeit auf denjenigen Zeitpunkt abzustellen, in dem der Schutzsuchende diejenige Handlung vorgenommen bzw. letztmalig unterlassen habe oder diejenigen Angaben gemacht habe, die die Offensichtlichkeitsentscheidung nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AsylG tragen würden. Im Rahmen von § 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AsylG bedeute dies, dass es in der Regel auf den Zeitpunkt der Anhörung ankomme.
-
Griechenland erneut wegen menschenrechtswidriger Aufnahmebedingungen verurteilt
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinem Urteil vom 23. Mai 2024 (Az. 65275/19, W.S. gg. Griechenland) erneut eine Verletzung der Rechte eines unbegleiteten minderjährigen Schutzsuchenden aus Art. 3 EMRK (Verbot der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung) durch griechische Behörden festgestellt. Der Beschwerdeführer war nach Stellung seines Asylantrags Ende 2019 einige Wochen auf sich allein gestellt und somit obdachlos, bevor er für wiederum mehrere Wochen auf einer Polizeistation in „Schutzgewahrsam“ genommen wurde. Der Gerichtshof habe bereits festgestellt, dass die Staaten an den Außengrenzen der Europäischen Union erhebliche Schwierigkeiten hätten, einen wachsenden Strom von Migranten und Asylsuchenden zu bewältigen. Angesichts des absoluten Charakters von Art. 3 EMRK könne dies einen Staat jedoch nicht von seinen Verpflichtungen aus dieser Bestimmung befreien.
-
Erfolglose Landesverfassungsbeschwerde gegen abgelehnten Eilrechtsschutz
Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin hat mit Beschluss vom 17. April 2024 (Az. 15/24) eine Verfassungsbeschwerde als unzulässig zurückgewiesen, die mit der Begründung erhoben worden war, dass ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin den Beschwerdeführer unter anderem in seinem Grundrecht auf ein faires Verfahren gemäß Art. 7 der Verfassung von Berlin in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip verletzt habe, weil es die in seinem Asylverfahren nicht möglich gewesene vertrauliche Besprechung mit seiner Rechtsanwältin vor der Anhörung und eine fehlende ordnungsgemäße Belehrung des Beschwerdeführers über seine Mitwirkungspflichten nicht berücksichtigt habe. Eine Verfassungsbeschwerde sei nur zulässig, so der Verfassungsgerichtshof, wenn der Beschwerdeführer hinreichend deutlich die konkrete Möglichkeit darlege, dass er durch die beanstandete Maßnahme der öffentlichen Gewalt des Landes Berlin in einem seiner in der Verfassung von Berlin enthaltenen Rechte verletzt sein könne, was eine Auseinandersetzung mit der Begründung der angefochtenen Entscheidung voraussetze. An einer solchen Auseinandersetzung habe es in der Verfassungsbeschwerde gefehlt.
Die Kommentarfunktion findet sich bei den einzelnen Beiträgen: Einfach auf die Überschrift klicken, um zum jeweiligen Beitrag zu gelangen.
Neu im Blog
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026
Indiz- und Bindungswirkung vorläufiger Maßnahmen des UN-Sozialauschusses?
20. Januar 2026
Im Oktober 2025 hat der UN-Sozialausschuss in einer Eilentscheidung entschieden, dass Deutschland einer vom Leistungsausschluss in Dublin-Fällen betroffenen Person existenzsichernde Leistungen gewähren muss. Dieser Beitrag analysiert die Entscheidung und beantwortet die Frage, ob ihr eine Indiz- und Bindungswirkung zukommt …
Dublin und die Drittstaaten
1. Januar 2026