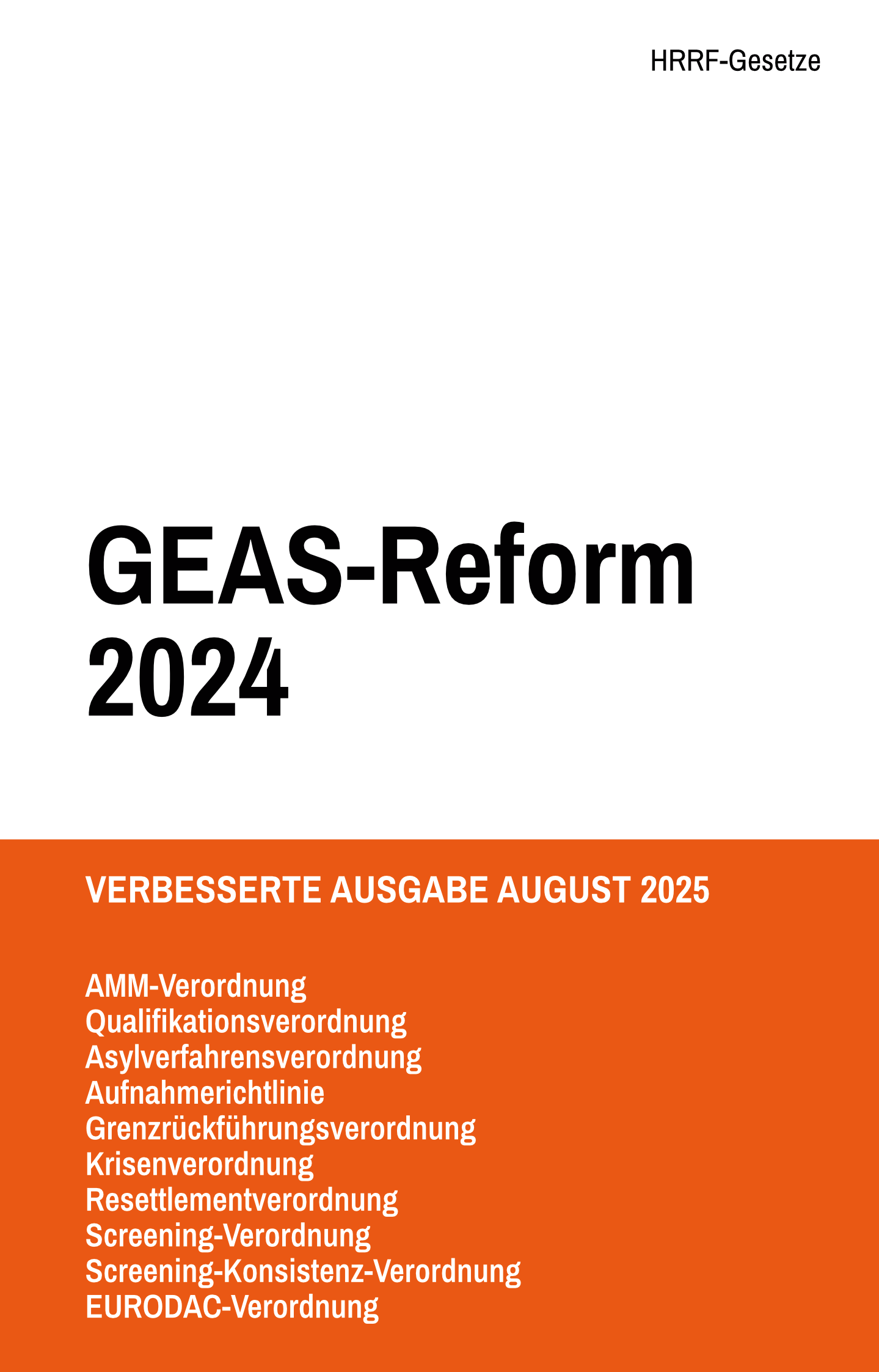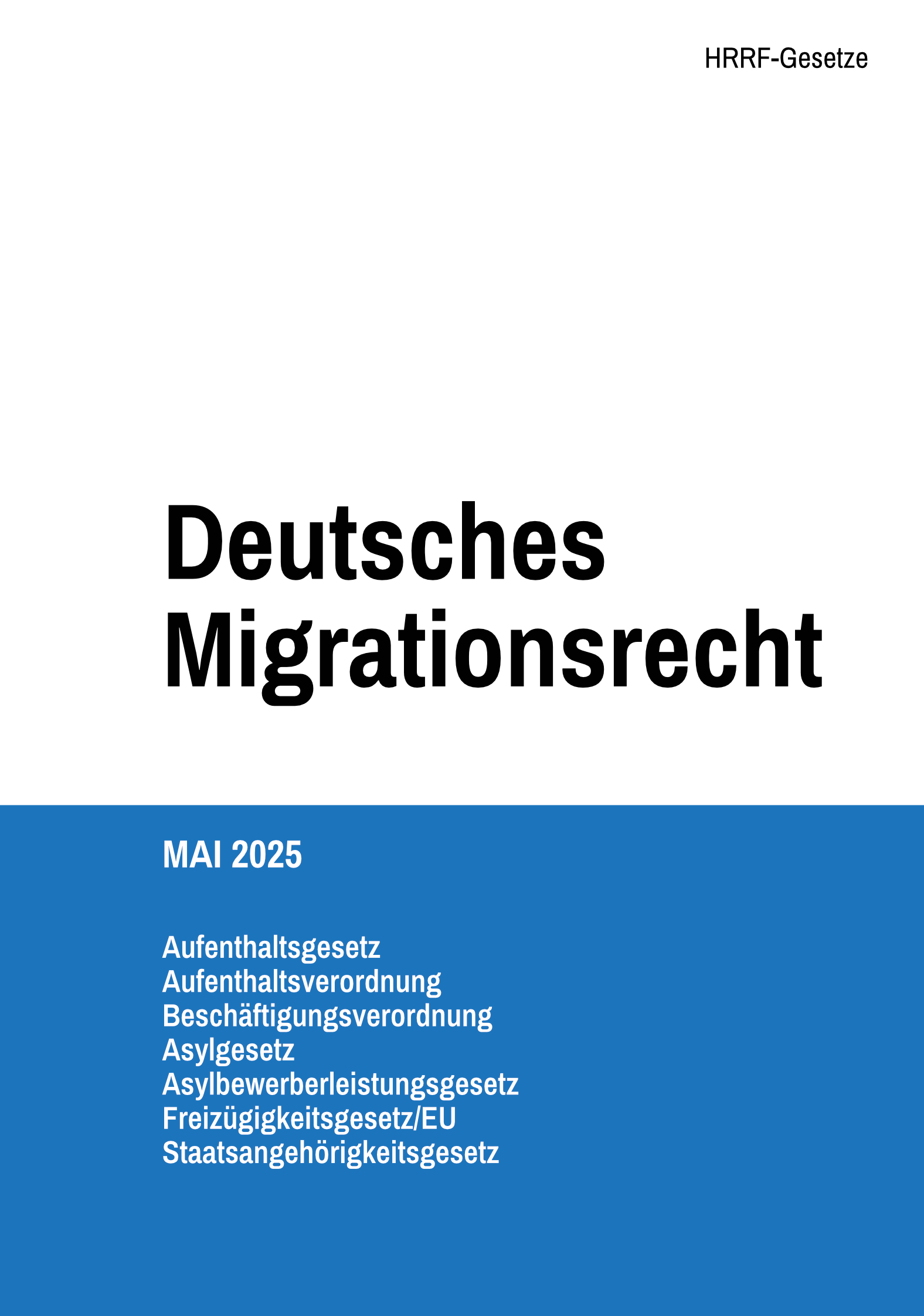Ich werde mir es in Zukunft gut überlegen müssen, ob ich Newsletter-Pausen wie in der vergangenen Woche noch einmal einlege. In zwei Wochen kann so viel passieren, und hat sich konkret so viel Rechtsprechung angehäuft, dass ich in dieser Newsletter-Ausgabe nur anfangen kann, den Berg neuer und spannender Gerichtsentscheidungen abzutragen. In der nächsten Woche geht es weiter, versprochen!
EuGH soll begründete Furcht definieren
Ein spannendes neues Vorabentscheidungsersuchen (Rs. C-440/25) ist vor kurzem beim Europäischen Gerichtshof gelandet, in dem es unter anderem um die Frage geht, was unter „begründeter Furcht“ vor Verfolgung im Sinne von Art. 2 Buchst. d der EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU zu verstehen ist. Das vorlegende niederländische Gericht schlägt vor, für die Beantwortung dieser Frage auf das vom deutschen Bundesverwaltungsgericht formulierte Kriterium eines besonnenen und vernünftig denkenden Menschen abzustellen, so dass gefragt werden müsse, ob aus Sicht eines besonnenen und vernünftig denkenden Menschen in der Lage des Asylsuchenden nach Abwägung aller bekannten Umstände eine Rückkehr in das Heimatland als unzumutbar erscheine. Eine mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnung sei demgegenüber meistens unmöglich, da der ganz überwiegende Teil der Länderinformationen qualitativer Art sei.
Die niederländische Sprachfassung des Vorabentscheidungsersuchens ist deutlich umfangreicher ausgefallen als die vom Gerichtshof bereitgestellte deutsche Übersetzung und enthält außerdem zahlreiche Fußnoten, wenngleich die Rechtsprechung des deutschen Bundesverwaltungsgerichts nur auf dem Umweg über den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 17. August 2018 (Az. 2 LA 1584/17) zitiert wird. In dem Verfahren geht es nicht nur um die Frage, was begründete Furcht ist, sondern auch um die Glaubhaftmachung der Zugehörigkeit „verwestlichter“ Frauen zu einer bestimmten sozialen Gruppe und um nationale Kompetenzverteilungen zwischen Asylbehörden und Gerichten. Im Verfassungsblog stellen Türkan Ertuna Lagrand und Salvatore Nicolosi das Vorabentscheidungsersuchen im Detail vor.
EGMR stoppt noch mehr griechische Abschiebungen
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einem Bericht vom 29. August 2025 zufolge in vier Verfahren einstweilige Anordnungen gegen Griechenland erlassen, die es dem Land verbieten, eritreische Schutzsuchende abzuschieben, ohne ihnen zuvor Zugang zu einem Asylverfahren gegeben zu haben. Griechische Behörden sollen es unter Verweis auf das im Juli 2025 verabschiedete griechische Gesetz zur Aussetzung des Rechts auf Stellung eines Asylantrags für bestimmte Schutzsuchende zuvor abgelehnt haben, die Asylanträge der Betroffenen entgegenzunehmen oder zu prüfen.
Der Gerichtshof hatte bereits Mitte August 2025 in acht Verfahren einstweilige Anordnungen gegen Griechenland erlassen, in denen es um ähnlich betroffene Schutzsuchende aus dem Sudan ging.
Sperrwirkung ausländischer Flüchtlingsanerkennung
Wenn Sie (1.) in einem anderen EU-Staat als Deutschland als Flüchtling anerkannt wurden, und wenn Sie (2.) danach in Deutschland einen weiteren Asylantrag gestellt haben und wenn (3.) außerdem feststeht, dass Ihnen im (ersten) EU-Staat (in dem Sie bereits als Flüchtling anerkannt wurden) eine menschenrechtswidrige Behandlung droht, dann wird das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ihren (zweiten) Asylantrag inhaltlich prüfen. Was passiert nun, wenn das Bundesamt bei dieser Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass Ihnen im Ihrem Herkunftsstaat keine Verfolgung, kein ernsthafter Schaden usw. drohen? Darf Ihnen die Abschiebung in Ihren Herkunftsstaat angedroht werden, obwohl es ja noch eine Flüchtlingsanerkennung aus dem anderen EU-Staat gibt, die genau das verbietet? Die Antwort auf diese Frage ist umstritten, die Verwaltungsgerichte Hannover (Urteil vom 14. August 2025, Az. 3 A 4909/22) und Köln (Urteil vom 18. August 2025, Az. 27 K 3863/22.A) beantworten sie aktuell so, dass die Abschiebung in den Herkunftsstaat nicht angedroht werden darf, und zwar unter Bezugnahme auf § 60 Abs. 1 S. 2 AufenthG. Andere Gerichte haben es anders gesehen, etwa das Verwaltungsgericht Hamburg Ende 2024.
Die im Urteil des Verwaltungsgerichts Köln zugelassene Sprungrevision wurde anscheinend eingelegt, so dass es in Bälde eine höchstrichterliche Klärung der Frage geben sollte. Beim Verwaltungsgerichtshof München ist außerdem ein Berufungsverfahren anhängig, in dem die Frage ebenfalls relevant ist. Sofern Sie übrigens in dem anderen EU-Staat keinen Flüchtlingsschutz erhalten haben, sondern nur subsidiären Schutz, ist es wieder alles anders als oben geschildert, aber das nur am Rande.
Bundesregierung reagiert auf Zwangsgeldandrohung in Afghanistan-Verfahren
Nachdem das Verwaltungsgericht Berlin der Bundesregierung Ende August 2025 Zwangsgelder angedroht hatte, falls (offenbar mehrere) rechtskräftige Eilbeschlüsse des Gerichts zur Einreise afghanischen Familien mit Aufnahmezusage aus Deutschland nicht umgesetzt würden, ist mittlerweile Bewegung in einige der vom Verwaltungsgericht entschiedenen Verfahren gekommen. Laut einem Medienbericht vom 1. September 2025 (Paywall) soll noch im Laufe des Tages ein erstes Flugzeug mit zehn afghanischen Familien von Pakistan nach Deutschland fliegen.
In dem Medienbericht heißt es außerdem, dass das Verwaltungsgericht bislang in 54 Eilverfahren afghanischer Familien entschieden hat und dass 84 weitere Eilverfahren anhängig sind.
OVG Berlin-Brandenburg lehnt ein paar Afghanistan-Anträge ab
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat Ende August 2025 drei Beschlüsse veröffentlicht, in denen es in Eilverfahren einen Anspruch afghanischer Familien mit Aufnahmezusage auf Einreise nach Deutschland abgelehnt hat. In den Beschlüssen vom 22. August 2025 (Az. 6 S 44/25) und vom 28. August 2025 (Az. 6 S 47/25) ging es um Aufnahmezusagen nach § 22 S. 2 AufenthG, die einen rein innerbehördlichen Charakter hätten, so dass Betroffene daraus keine Rechte ableiten könnten. Selbst wenn man das anders sähe, hätte die Bundesregierung die in den Verfahren erteilten Aufnahmezusagen nicht aufgehoben, sondern lediglich suspendiert, und es bestehe jedenfalls kein Anspruch darauf, das Ausreiseverfahren in einem bestimmten Zeitraum durchzuführen. Zum Beschluss vom 28. August 2025 gibt es mittlerweile eine Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichts. In dem Beschluss vom 26. August 2025 (Az. 6 S 51/25), über den das Oberverwaltungsgericht auch in einer Pressemitteilung berichtet, ging es dagegen um eine Aufnahmezusage gemäß § 23 Abs. 2 AufenthG. Aus einer solchen Aufnahmezusage folge für sich genommen noch kein Anspruch auf Visumerteilung, sondern nur auf Durchführung des Visumverfahrens, das wie sonst auch eine persönliche Vorsprache bei der für die Antragstellung zuständigen deutschen Auslandsvertretung voraussetze, um in deren Rahmen neben der gebotenen Prüfung der Identität des Nachzugswilligen vor dessen Einreise in das Bundesgebiet zu klären, ob in Bezug auf die jeweilige Person Sicherheitsbedenken bestünden. Eine solche persönliche Vorsprache habe in dem Verfahren aber bislang aus Gründen nicht stattgefunden, die nicht der Auslandsvertretung zuzurechnen seien.
Das Oberverwaltungsgericht scheint keine grundsätzlichen Probleme mit den zahlreichen stattgebenden Eilbeschlüssen des Verwaltungsgerichts Berlin zu haben (die Bundesregierung ja offenbar auch nicht). Insofern soll die Veröffentlichung gerade dieser drei Beschlüsse wohl eher der Abgrenzung bestimmter Fallkonstellationen dienen, in denen einstweiliger Rechtsschutz und damit eine Vorwegnahme der Hauptsache aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts nicht in Frage kommen.
BVerwG setzt Italien-Tatsachenrevisionen aus
Das Bundesverwaltungsgericht berichtet in einer Pressemitteilung vom 28. August 2025 darüber, dass es sechs bei ihm anhängige Tatsachenrevisionen ausgesetzt hat, in denen es um Dublin-Überstellungen nach Italien geht. Beim Europäischen Gerichtshof sei derzeit ein Vorabentscheidungsersuchen (Rs. C-458/24) anhängig, in dem es um die Frage der Rechtsfolgen einer fehlenden Aufnahmebereitschaft eines Mitgliedstaats gehe. Die Beantwortung dieser Frage sei auch für die beim Bundesverwaltungsgericht anhängigen Verfahren entscheidungserheblich, so dass der Ausgang des beim Europäischen Gerichtshofs anhängigen Verfahrens abgewartet werden solle.
Einen Teil der im Verfahren C-458/24 aufgeworfenen Fragen hatte der Europäische Gerichtshof schon in seinem Urteil vom 19. Dezember 2024 (Rs. C‑185/24 und C‑189/24) beantwortet: Die fehlende Aufnahmebereitschaft Italiens führe jedenfalls nicht gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO zur Annahme systemischer Schwachstellen in Italien. In dem jetzt noch beim Gerichtshof anhängigen Verfahren geht es aber daneben auch darum, ob nicht auch ohne systemische Schwachstelle ein in der Dublin-III-VO so nicht vorgesehener Systembruch vorliegt, und welche Folgen er hat, etwa im Hinblick auf die Zulässigkeit einer Ablehnung von Asylanträgen als unzulässig. Der Gerichtshof hatte in seinem Urteil im Dezember 2024 übrigens bereits gesagt, dass der nach der Dublin-III-VO zuständige Mitgliedstaat sich seiner Pflichten nicht einseitig entledigen dürfe (Rn. 42 des Urteils). Das würde ich mal vorsichtig in die Richtung interpretieren, dass es am Ende auf das Inkaufnehmen einer temporären Refugee-in-Orbit-Situation hinauslaufen könnte, bis die Frist für eine Überstellung in den nicht aufnahmebereiten Dublin-Staat abgelaufen ist.
Ehepaare schon wieder nicht von Griechenland-Urteilen erfasst
Auch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Beschluss vom 27. August 2025, Az. 18a L 1375/25.A) und das Verwaltungsgericht Hannover (Beschluss vom 6. August 2025, Az. 2 B 7190/25) meinen jetzt, dass Ehepaare mit einer Schutzberechtigung für Griechenland nicht von den Griechenland-Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts aus dem April 2025 erfasst werden. Diese Rechtsprechung könne nicht ohne Weiteres auf die Personengruppe der in Griechenland als schutzberechtigt anerkannten (kinderlosen) Ehepaare zur Anwendung gebracht werden.
Das hatten unlängst bereits die Verwaltungsgerichte Aachen und Hamburg so gesehen.
Niedrige Zivilisationsgrade am Verwaltungsgericht Minden
In seinem Beschluss vom 28. Juni 2025 (Az. 3 L 1160/25.A) hatte das Verwaltungsgericht Minden keine Einwände gegen die Abschiebung eines Straftäters nach Afghanistan und hat die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage des Betroffenen gegen den Widerruf der zuvor für ihn festgestellten Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG abgelehnt. Der Betroffene (der übrigens Mitte Juli 2025 nach Afghanistan abgeschoben wurde) habe „durch sein in der Bundesrepublik Deutschland gezeigtes Verhalten eine derartige Robustheit und die Interessen anderer ausschließende Durchsetzungsfähigkeit sowie Widerstandskraft unter Beweis gestellt“, dass die sichere Prognose getroffen werden könne, er „werde sich trotz der derzeit äußerst schwierigen humanitären Bedingungen in Afghanistan dort schon durchschlagen können“. Insbesondere sein in Deutschland strafrechtlich geahndetes Verhalten belege „anschaulich seine mangelnde Integrationsfähigkeit in die hiesige Rechts- und Gesellschaftsordnung“ und lege „den Schluss nahe, dass er in einer Rechts- und Gesellschaftsordnung mit niedrigerem Zivilisationsgrad besser aufgehoben sein und dort sogar mehr aus seinem Leben machen könnte“.
Der Beschluss zeigt, dass es mit der praktischen Gewährleistung der von § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG in Bezug genommenen Menschenrechte, namentlich des in Art. 3 EMRK enthaltenen Non-Refoulement-Gebots, nicht mehr weit her ist, wenn man nur die Gefahr, und damit die Gefahrenabwehr, eindrücklich genug in den Vordergrund stellt. Es ist kein Zufall, dass die vom Betroffenen in Deutschland verübten Straftaten in Rn. 20 des Beschlusses so ausführlich wie hyperbolisch und fast genussvoll beschrieben werden: Da ist die Rede von einer „empfindlichen“ Freiheitsstrafe, vom „mehrfach“ gezeigten „aktenkundigen“ Verhalten, von der „gefährlichen“ Körperverletzung unter Verwendung eines „gefährlichen“ Werkzeugs, vom „körperlichen“ Übergriff, von „manipulierten“ Drogentests und von „aggressivem“ Verhalten. Der Betroffene hat sich nicht nur nicht integriert, er ist nicht einmal integrationsfähig. Wenn aus Sicht des Gerichts der Schluss naheliegt, dass der Betroffene in einer Rechts- und Gesellschaftsordnung mit „niedrigerem Zivilisationsgrad“ besser aufgehoben ist, dann liegt auch der Schluss nahe, dass das Gericht ihm selbst einen lediglich niedrigerem Zivilisationsgrad zusprechen will. Eines solchen Rückgriffs auf rassistische Stereotype hätte es aber gar nicht bedurft, weil das Gericht ohnehin meint (Rn. 21), dass der Betroffene gesund und arbeitsfähig ist und in der deutschen JVA eine Weiterbildung abgeschlossen und damit Fähigkeiten erworben hat, die ihm „auch in Afghanistan von Nutzen sein können“, so dass er sozusagen wenigstens einige Weihen einer höheren Zivilisation erfahren hat. Das ist natürlich alles keine ernsthafte Auseinandersetzung eines Gerichts mit der Rechtslage, zumal dieselbe Kammer die Lage in Afghanistan nur vier Wochen zuvor auch für alleinstehende und arbeitsfähige junge Männer noch in düstersten Farben geschildert hatte. Die Kammer möge bitte einmal in sich gehen, welchen Zivilisationsgrad sie selbst hier demonstriert hat, und ob sie sich, und der Verwaltungsgerichtsbarkeit, mit diesem Beschluss einen Gefallen getan hat.
Haftgerichte müssen Abschiebungshindernisse (manchmal) prüfen
Der Europäische Gerichtshof hat in seinem (gerade noch nicht in deutscher Sprachfassung erhältlichen) Urteil vom 4. September 2025 (Rs. C-313/25 PPU, Adrar) die EU-Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG ausgelegt und meint, dass nationale Haftgerichte bei der Verhängung oder Überprüfung von Abschiebungshaft „gegebenenfalls“ von Amts wegen zu prüfen haben, ob die Abschiebung rechtlich zulässig ist oder ob ihr die in Art. 5 der Richtlinie geregelten Gründe entgegenstehen, insbesondere der Grundsatz der Nichtzurückweisung sowie das Wohl des Kindes und familiäre Bindungen.
Das Urteil ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Fortführung des Ararat-Urteils des Gerichtshofs vom 17. Oktober 2024 (Rs. C-156/23) und die Übertragung seiner Grundsätze auf die Abschiebungshaft: Haftgerichte werden Abschiebungshindernisse künftig manchmal prüfen müssen. In Deutschland sind für eine solche Prüfung derzeit (und wohl auch künftig) die Verwaltungsgerichte zuständig, so dass eine weitere Prüfung durch die als Haftgerichte agierenden Amts- und Landgerichte zu durchaus interessanten Fragestellungen führen dürfte. Ganz so einfach ist es vermutlich aber auch wieder nicht: Schon bei der Interpretation des Ararat-Urteils gab es Unklarheiten hinsichtlich der Reichweite der Aussagen des Gerichtshofs, die zum Beispiel das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in seinem Beschluss vom 16. Mai 2025 (Az. 13 ME 32/25) gut zusammenfasst. Diese Unklarheiten sind im neuen Urteil ebenso angelegt, in dem es heißt, dass die Haftgerichte „le cas échéant“, also „gegebenenfalls“ (oder „erforderlichenfalls“, wie es in der deutschen Übersetzung des Vorabentscheidungsersuchens heißt) prüfen müssen, aber eben nicht immer.
Mal wieder asylgerichtliche Verfahrensbeschleunigung geplant
Der Bundesrat sieht dringenden Handlungsbedarf, nämlich bei der Beschleunigung asylgerichtlicher Verfahren, und schlägt zu diesem Zweck eine Änderung der §§ 78 und 80 des Asylgesetzes vor (siehe BT-Drs. 21/1380 vom 27. August 2025). Der Gesetzentwurf will das Berufungszulassungs- und das Beschwerderecht in Asylsachen reformieren, indem Verwaltungsgerichte in Hauptsacheverfahren bei grundsätzlicher Bedeutung oder Divergenz die Berufung zulassen können sollen, in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes bei grundsätzlicher Bedeutung die Beschwerde. Außerdem sollen Berufungszulassungsverfahren in bestimmten Fällen dem Einzelrichter übertragen werden können.
Die Bundesregierung hält nicht viel von dem aus Niedersachsen eingebrachten Vorschlag des Bundesrats (S. 14 der Drucksache), sondern sieht vielmehr die Gefahr einer weiteren Verfahrensverzögerung durch Aussetzung erstinstanzlicher Verfahren, wenn Berufungsverfahren anhängig sind. Außerdem beschränke sich die bezweckte Rechtsvereinheitlichung auf den Bezirk des jeweiligen Oberverwaltungsgerichts. Der Gesetzentwurf verweist zur Begründung der in ihm verfolgten Maßnahmen übrigens auf die Abschlusserklärung der Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte und Verwaltungsgerichtshöfe der Länder sowie des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Oktober 2017 (!).
Neu im Blog
-
Aktuelle EuGH-Urteile vom 1.8.2025
Etwas zu spät für den HRRF-Newsletter an diesem Freitag hat der Europäische Gerichtshof heute Mittag drei Urteile zum europäischen Flüchtlingsrecht verkündet. Alle drei Urteile sind noch nicht mittlerweile in deutscher Sprache verfügbar, zu zwei der drei Urteile gibt es außerdem…
-
Monatsübersicht Mai 2025
Die HRRF-Monatsübersicht für Mai 2025 ist zum Download verfügbar und bietet auf zehn Seiten eine praktische Zusammenfassung aller im Monat Mai 2025 im HRRF-Newsletter vorgestellten Entscheidungen. Highlights dieser Monatsübersicht sind:
-
Monatsübersicht April 2025
Die HRRF-Monatsübersicht für April 2025 ist zum Download verfügbar und bietet auf sechs Seiten eine praktische Zusammenfassung aller im Monat April 2025 im HRRF-Newsletter vorgestellten Entscheidungen. Highlights dieser Monatsübersicht sind:
Neueste Bücher