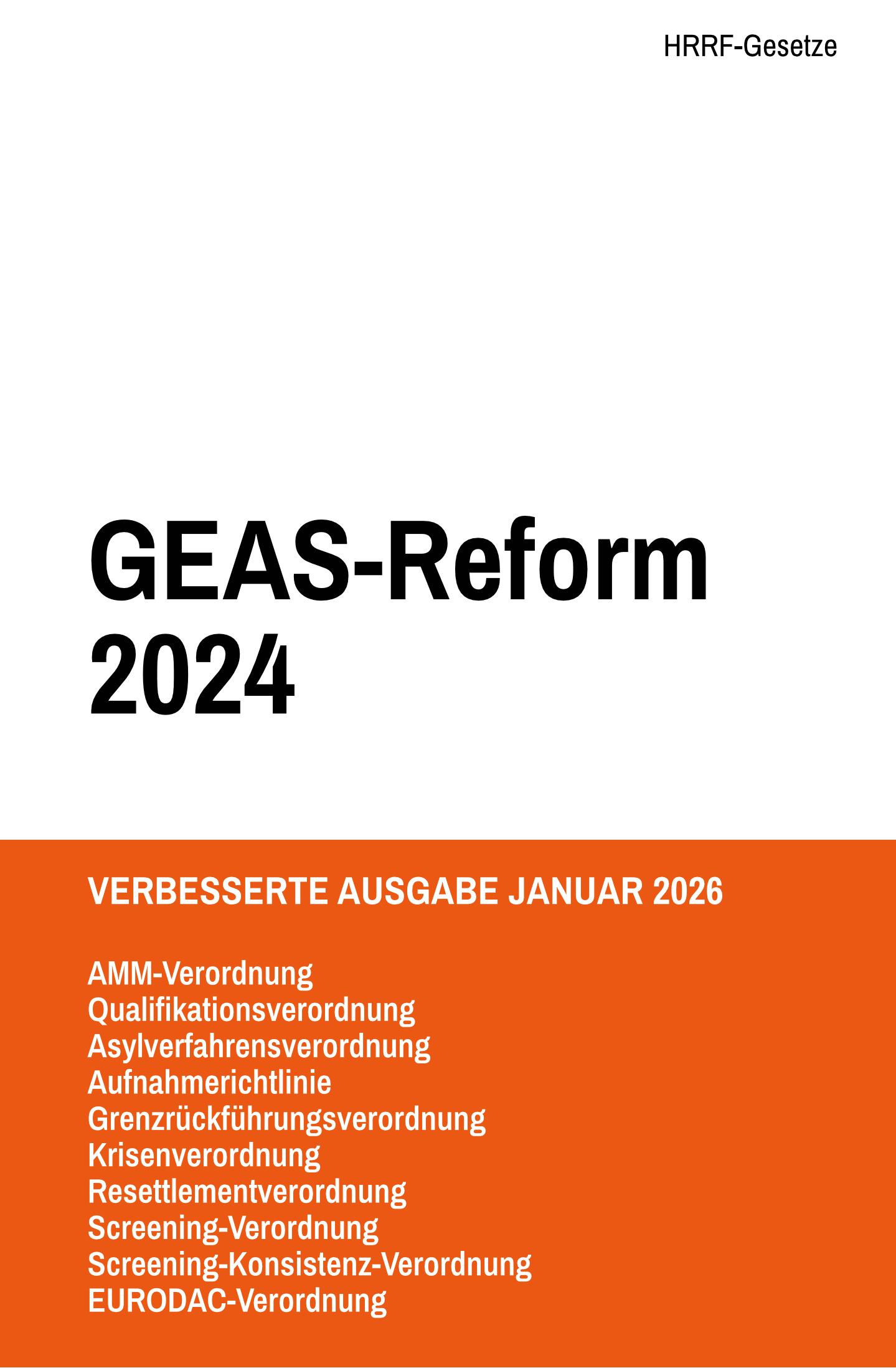Es geht in dieser Woche um Pest und Cholera, jedenfalls sinnbildlich, um die „Abkehr“ der Bundesregierung von ihrem früheren Tun bei Afghanistan-Aufnahmen, um Mindestanforderungen an den Vortrag von Vulnerabilitäten in Dublin-Verfahren, den Zustand des polnischen Asylsystems, Menschenrechtsverletzungen bei endlosen Behördenverfahren, Altersfeststellung und Versagung von Prozesskostenhilfe, um den Ausschluss von einer Einbürgerung und um die Haftung für Abschiebungskosten. Man hätte auch noch mehr schreiben können, aber so bleiben noch ein paar Entscheidungen für die kommende Woche übrig.
Ausländische Schutzgewährung soll nicht vor Abschiebung schützen
Das Bundesverwaltungsgericht berichtet in einer Pressemitteilung vom 19. Februar 2026 über seine noch nicht im Volltext vorliegenden Urteile vom selben Tag (Az. 1 C 16.25 und 1 C 24.25), in denen es entschieden hat, dass die Gewährung internationalen Schutzes in einem anderen EU-Staat es deutschen Behörden nicht verbietet, die Abschiebung in den Herkunftsstaat anzudrohen, wenn die Schutzberechtigten von Deutschland nicht in den anderen EU-Staat abgeschoben werden dürfen, weil dort eine menschenrechtswidrige Behandlung droht. In solchen Fälle dürften deutsche Behörden nicht an die ausländische Entscheidung zur Gewährung internationalen Schutzes gebunden sein, so das Bundesverwaltungsgericht, und müsse § 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 AufenthG („[..] darf ein Ausländer nicht [..] abgeschoben werden [..] Dies gilt auch für Asylberechtigte und Ausländer, [..] die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind.“) in einer Weise teleologisch reduziert werden, dass das dort geregelte Refoulement-Verbot der Androhung einer Abschiebung des Ausländers in das Herkunftsland nicht entgegenstehe.
Diese Entscheidungen können nicht richtig sein: Schutzberechtigte sollen die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, sozusagen, also zwischen Menschenrechtsverletzungen im ersten EU-Aufnahmestaat oder im Herkunftsstaat, nur weil sie im falschen (obwohl gemäß der Dublin-III-Verordnung zuständigen!) EU-Staat (in der Regel: Griechenland) Schutz beantragt und erhalten haben, in den Deutschland sie nach anschließender Sekundärmigration wegen menschenrechtswidriger Aufnahme- und Lebensbedingungen nicht abschieben darf? Das eigentliche Problem ist doch zum einen, dass es in EU-Staaten überhaupt menschenrechtswidrige Aufnahme- und Lebensbedingungen geben kann, über Jahre, zum anderen, dass zwei Asylentscheidungen zur selben Person innerhalb der EU inhaltlich divergieren können, obwohl es ein „gemeinsames“ europäisches Asylsystem gibt. Dieses Problem wird auch die GEAS-Reform nicht lösen. Stattdessen wird munter an den Symptomen geschraubt, indem Sekundärmigration sinngemäß verboten wird.
Parallel versucht das Bundesverwaltungsgericht, die in § 60 AufenthG vorgesehene Bindung an die ausländische Flüchtlingsanerkennung genauso zu umgehen (zu „reduzieren“) wie das Urteil des Europäischen Gerichtshof vom 18. Juni 2024 (Rs. C-753/22), in dem eine solche Bindung europarechtlich hergeleitet wurde. Da hilft auch der floskelhafte Verweis („unter umfassender Berücksichtigung der Schutz gewährenden Entscheidung des anderen Mitgliedstaats“) auf das EuGH-Urteil nichts, weil in der Praxis überhaupt nicht(s) berücksichtigt, sondern höchstens indifferent zur Kenntnis genommen wird. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass es am 18. Juni 2024 noch ein weiteres EuGH-Urteil gab (Rs. C-352/22), in dem der Gerichtshof im Kontext des Auslieferungsrechts vor einer Auslieferung (hier: Abschiebung) einen ausdrücklichen Widerruf der im ersten Mitgliedstaat zuerkannten Flüchtlingsanerkennung gefordert hat, hätte das Bundesverwaltungsgericht doch ein erneutes Vorabentscheidungsverfahren initiieren müssen? Der Europäische Gerichtshof ist gesetzlicher Richter im Sinne des grundrechtsgleichen Art. 101 Abs. 1 GG, dessen Verletzung mit einer Verfassungsbeschwerde gerügt werden kann.
Weitere Eilentscheidungen zu Afghanistan-Aufnahmen
Am Verwaltungsgericht Berlin sind offenbar nach wie vor zahlreiche Verfahren anhängig, in denen es um die Aufnahme von Schutzsuchenden aus Afghanistan im Kontext deutscher Aufnahmeerklärungen geht. Dabei gibt es auch Verfahren zu Aufnahmezusagen gemäß § 23 Abs. 2 AufenthG, etwa den Beschluss der 40. Kammer vom 5. Januar 2026 (Az. 40 L 524/25 V), die aber weniger zahlreich zu sein scheinen als die Verfahren, in denen die Bundesregierung eine bloße Aufnahmeerklärung abgegeben und somit „nur“ nach § 22 S. 2 AufenthG agiert hat. Zu den Unterschieden zwischen den beiden Arten von Aufnahmen hatte ich im letzten Sommer mal was aufgeschrieben, aus dem Januar 2026 sind mir vier Beschlüsse aufgefallen, in denen es um § 22 S. 2 AufenthG ging.
Terminologisch scheint sich dabei beim Verwaltungsgericht mittlerweile der eigentlich komplett unjuristische Begriff der „Abkehr“ durchgesetzt zu haben, um das Vorgehen der Bundesregierung zu beschreiben, die von ihren Aufnahmeerklärungen nichts mehr wissen will. Die letztes Jahr noch gebräuchlichen Begriffe der „Rücknahme“ oder des „Widerrufs“ von Aufnahmeerklärungen passen nämlich zumindest bei Aufnahmeerklärungen gemäß § 22 S. 2 AufenthG eigentlich nicht, weil es sich um juristische Fachbegriffe mit einer feststehenden Bedeutung handelt ( siehe § 48 und § 49 VwVfG), die nur für Verwaltungsakte gelten, während Aufnahmeerklärungen nach § 22 S. 2 AufenthG gerade keine Verwaltungsakte sind (anders als Aufnahmezusagen nach § 23 Abs. 2 AufenthG).
Jedenfalls verstößt die Abkehr der Bundesregierung von ihren eigenen Afghanistan-Aufnahmeerklärungen (d.h. nach § 22 S. 2 AufenthG abgegebenen Erklärungen) nach Meinung der 41. Kammer des Verwaltungsgerichts in ihrem Beschluss vom 6. Januar 2026 (Az. 41 L 763/25 V) weder gegen den Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung noch gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, außerdem stehen ihre keine staatlichen Schutzpflichten entgegen. Allerdings müsse die Entscheidung über die Abkehr einer verwaltungsgerichtlichen Willkürkontrolle standhalten, die jedoch nur dann stattfinden könne, wenn die Entscheidung über die Abkehr überhaupt begründet sei.
Der Beschluss diskutiert ausführlich (Rn. 55ff.), ob nicht statt einer Begründung im Einzelfall auch die öffentliche Erklärung der Bundesregierung am 10. Dezember 2025 ausreicht, dass an einer Aufnahme afghanischer Staatsangehöriger allgemein kein politisches Interesse mehr besteht. Im Prinzip sei diese Erklärung nicht willkürlich, so die Kammer, allerdings habe die Bundesregierung dann doch wieder im Einzelfall Ausnahmen gemacht und ihr Interesse erneut erklärt, was zur Notwendigkeit einer Begründung im Einzelfall führe. Dazu hat die Kammer die Bundesregierung dann auch mit einer Frist von sieben Tagen verpflichtet.
Die 33. Kammer geht in ihrem Beschluss vom 16. Januar 2026 (Az. 33 L 585/25 V) einen Schritt weiter und sagt, dass eine Aufnahmeerklärung schon gar nicht beseitigt wurde, wenn die Abkehr nicht ausreichend begründet ist. Außerdem argumentiert sie, dass sich der Begründungszwang auch aus Gründen des Vertrauensschutzes ergebe.
Wenn ich das richtig verstehe, argumentiert die Kammer offenbar (Rn. 30ff.), dass eine Abkehrentscheidung ohne Begründung willkürlich und damit unwirksam ist, die ausreichende Begründung also ein konstitutives Wirksamkeitserfordernis für eine Abkehr darstellt.
Die 38. Kammer sieht es in ihrem Beschluss vom 29. Januar 2026 (Az. 38 L 163/26 V) ähnlich und fordert ein „Mindestmaß an Nachvollziehbarkeit“ für die Abkehrentscheidung.
In diesem Beschluss wird gefordert, dass die Entscheidung auf die individuellen Gefährdungsumstände des Einzelfalles eingehen muss (Rn. 21), sich also nicht in allgemeinen Ausführungen zum Wegfall eines politischen Interesses erschöpfen darf.
Wie so eine individuelle Entscheidung aussehen könnte, zeigt die 38. Kammer in einem weiteren Beschluss vom 29. Januar 2026 (Az. 38 L 422/25 V). In dem hier entschiedenen Verfahren hatte die deutsche Botschaft im Herbst 2025 in einem internen Vermerk festgehalten, dass eine unmittelbare, individuelle Gefährdungslage nicht festgestellt werden könne. Dies hielt die Kammer für ausreichend, um Willkür auszuschließen.
Die Kammer fasst das ganze Elend des Umgangs mit den Aufnahmeerklärungen zusammen (Rn. 34) und meint, dass die Erklärung einer Aufnahme „Ausdruck autonomer Ausübung staatlicher Souveränität“ sei. Soweit die Antragstellerin geltend gemacht habe, dass es nur ein zeitlicher Zufall sei, dass sie (lediglich) eine Aufnahmeerklärung (nach § 22 S. 2 AufenthG) und keine Aufnahmezusage (nach § 23 Abs. 2 AufenthG) erhalten habe, ändere dies nichts, denn es hätte im freien politischen Ermessen der Bundesregierung gelegen, überhaupt tätig zu werden und bei der Aufnahme entweder nach § 22 S. 2 AufenthG oder nach § 23 Abs. 2 AufenthG vorzugehen.
Keine systemischen Mängel in Polen
In seinem Urteil vom 22. Dezember 2025 (Az. 39 K 263.19 A) meint das Verwaltungsgericht Berlin, dass es im polnischen Asylsystem keine systemischen Schwachstellen gibt. Wenngleich die Asylanträge der Klägerinnen nach einer Rückführung in Polen voraussichtlich als Folgeanträge behandelt würden, sei es unwahrscheinlich, dass sie ohne Überprüfung ihrer materiellen Asylgründe in ihren Herkunftsstaat Russland überstellt würden. Die aus Russland geflohenen Klägerinnen waren im Januar 2018 aus Polen nach Deutschland gereist und hatten Asylanträge gestellt, gegen die Ablehnung der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatten sie im Februar 2018 (!) Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben, über die jetzt entschieden wurde.
Das Urteil des Verwaltungsgerichts ergeht sich in Mutmaßungen über Änderungen der Rechtsprechung des polnischen Obersten Verwaltungsgerichts (Rn. 44f.), wenn es darum geht, ob die ursprünglichen (aus der Zeit vor 2018 stammenden) Verfolgungsgründe nunmehr (d.h. über acht Jahre später) erstmals inhaltlich in einem Asylverfahren in Polen vorgetragen werden könnten und inhaltlich berücksichtigt werden würden. In einem etwas anders gelagerten Verfahren hatte das Verwaltungsgericht Ansbach in seinem Beschluss vom 19. Januar 2026 (Az. AN 18 S 26.50000) unlängst auch keine Einwände gegen Dublin-Überstellungen nach Polen: Die Aussetzung des Zugangs zu einem Asylverfahren für bestimmte Schutzsuchende sei im konkreten Verfahren trotz der Einreise des Klägers über Belarus nicht relevant, weil Polen der Dublin-Rückübernahme zugestimmt habe.
Anforderungen an Vortrag zu Dublin-Vulnerabilitäten
Wird die Vulnerabilität im Hinblick auf eine Rückkehr nach Griechenland eines dort anerkannt Schutzberechtigten mit einer Erkrankung begründet, ist diese durch den Kläger näher zu substantiieren, wozu er sowohl bei psychischen als auch bei körperlichen Erkrankungen ein nur „gewissen Mindestanforderungen“ genügendes fachärztliches Attest vorzulegen hat, sagt das Verwaltungsgericht Berlin in seinem Urteil vom 16. Januar 2026 (Az. 43 K 420/25 A). Es sei nicht zu fordern, dass der Kläger ein ärztliches Attest vorlege, das die Anforderungen des § 60a Abs. 2c AufenthG an eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung zum Nachweis einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankung erfülle, weil der unionsrechtliche Begriff der Vulnerabilität und die diesbezügliche richterliche Bewertung im Drittstaatenverfahren durch § 60a Abs. 2c AufenthG weder definiert noch beschränkt würden. Ein medizinisches Gutachten sei aber nicht stets von Amts wegen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder das Gericht einzuholen, wenn die antragstellende Person Erkrankungen ohne hinreichenden Nachweis lediglich behaupte. Vielmehr stelle der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung fest, dass rechtsmedizinische Gutachten insbesondere dann einzuholen seien, wenn Anhaltspunkte dafür vorläge. Dazu, wann solche (hinreichenden) Anhaltspunkte für das Vorliegend von Erkrankungen anzunehmen seien, lasse sich seiner Rechtsprechung allerdings nichts entnehmen.
Das Verwaltungsgericht erläutert den von ihm geforderten Inhalt des Attests in seinem Urteil ausführlich (Rn. 41f.). Danach muss sich aus dem Attest nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat und wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Ins Attest gehören etwa Angaben darüber, seit wann und wie häufig sich der Patient in ärztlicher Behandlung befunden hat und ob die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestätigt werden. Des Weiteren soll das Attest Aufschluss über die Schwere der Krankheit, deren Behandlungsbedürftigkeit sowie den bisherigen Behandlungsverlauf geben und aktuell sein.
Menschenrechtsverletzung bei Vorenthaltung eines gesicherten Aufenthaltsrechts
Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) ist nicht auf ein bloßes Refoulement-Verbot beschränkt, sondern beinhaltet auch ein Recht auf Rechtssicherheit und letztlich gesicherten Aufenthalt. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Oktober 2025 gibt Anlass, dieses Recht genauer zu betrachten, was hier im HRRF-Blog gemacht wird.
Menschenrechtliche Anforderungen an die Altersfeststellung
Eine Entscheidung des UN-Kinderrechtsausschusses aus dem Mai 2024 erläutert die menschenrechtlichen Anforderungen an die Altersfeststellung am Beispiel des Dublin-Verfahrens: Bloße Plausibilitätsannahmen sind unzureichend und die Altersfeststellung muss zeitnah, kindgerecht, geschlechtersensibel und kulturell angemessen erfolgen. Im Zweifel muss die Vermutung der Minderjährigkeit gelten. Ein aktueller Beitrag im HRRF-Blog beschäftigt sich mit dieser Entscheidung.
Menschenrechtswidrige Ablehnung von Prozesskostenhilfe
Nicht in allen Staaten sind asylgerichtliche Verfahren wie in Deutschland (siehe § 83b AsylG) von der Zahlung von Gerichtskosten befreit. In der Schweiz gibt es solche Gerichtskosten und wird ein asylgerichtliches Verfahren erst durchgeführt, wenn der oder die Schutzsuchende die Gerichtskosten gezahlt hat. Das kann aus Sicht des UN-Ausschusses gegen Folter eine Menschenrechtsverletzung darstellen. Eine Entscheidung des Ausschusses aus dem April 2025 wird jetzt im HRRF-Blog analysiert.
Keine Einbürgerung bei Unterstützung linker gewaltorientierter Gruppierungen
In einer Pressemitteilung vom 9. Februar 2026 informiert das Verwaltungsgericht Stuttgart über sein noch nicht im Volltext vorliegendes Urteil vom 6. Februar 2026 (Az. 4 K 797/24), in dem es die Versagung einer Einbürgerung wegen des Vorliegens von Anhaltspunkten für das Unterstützen „linksextremistischer Bestrebungen“ für rechtmäßig gehalten hat. Der Kläger wirke im Rahmen seines privaten und beruflichen Engagements gegen Rassismus, Populismus und rechtsextreme Entwicklungen in breit aufgestellten Bündnissen jedenfalls auch mit lokalen gewaltorientierten linksextremistischen Gruppierungen zusammen. Dadurch würden die Aktionsmöglichkeiten und das Rekrutierungsfeld dieser Gruppierungen erweitert, ihnen der Anschein der Legitimität verschafft und ihre Stellung in der Gesellschaft begünstigt. Es sei nicht unverhältnismäßig, von einem Einbürgerungsbewerber zu erwarten, bei seinem Engagement auf die Einbindung und Unterstützung gewaltorientierter linksextremistischer Gruppierungen zu verzichten.
Behörde und Verwaltungsgericht gingen offenbar davon aus, dass der Kläger nicht (wie von § 11 Abs. 1 Nr. 1 StAG verlangt) glaubhaft gemacht hat, sich von seiner früheren Unterstützung der inkriminierten Gruppierungen abgewandt zu haben. Die Gewerkschaft Verdi hat gegen das Urteil protestiert, offenbar spielten auch Erkenntnisse des baden-württembergischen Verfassungsschutzes eine Rolle, der jedoch fehlerhaft gearbeitet haben soll.
Arbeitgeber haften für Abschiebungskosten
Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim weist in seinem Beschluss vom 27. Januar 2026 (Az. 11 S 2163/25) darauf hin, dass der (frühere) Arbeitgeber eines Ausländers für die Kosten der Abschiebung des Ausländers gemäß § 66 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 AufenthG schon dann haftet, wenn er den Ausländer unerlaubt beschäftigt hat und sich der Ausländer in dem Zeitraum zwischen der Beschäftigung und der Abschiebung stets ohne Aufenthaltstitel in Deutschland aufgehalten hat. Dagegen sei nicht erforderlich, dass ein Zusammenhang oder eine Kausalität zwischen der unerlaubten Beschäftigung und der Abschiebung vorliege.
Dem Unternehmen half weder der Hinweis auf eine (tatsächlich nicht vorliegende) „konkludente Arbeitserlaubnis“ noch das Argument, dass die erst Jahre nach Ende der Beschäftigung erfolgte Abschiebung gar nichts mit der unerlaubten Beschäftigung zu tun gehabt habe. Die unerlaubte Beschäftigung eines Ausländers trage immer zur Aufrechterhaltung eines rechtswidrigen Zustandes bei, so der Verwaltungsgerichtshof, was staatliches Einschreiten gerade auch deshalb erforderlich mache, um andere erwerbsbereite Ausländer von einer illegalen Einreise abzuhalten.
Vermischte Nachrichten KW 8/2026
- Vom 12. bis zum 14. Juni 2026 finden in Jena die ersten anwaltlichen Migrationsrechtstage statt. Unter dem Generalthema „Entgrenzt“ geht es um Grenzen und darum, sie zu überschreiten, zu hinterfragen und aufzulösen. Das klingt vielversprechend, das überaus spannende Programm gibt es hier. Anmeldungen sind noch bis Ende Februar 2026 möglich.
- Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat gemeinsam mit Kabul Luftbrücke eine Musterverfassungsbeschwerde für Schutzsuchende aus deutschen Aufnahmeprogrammen (166 Seiten ohne Anlagen!) veröffentlicht. Das Muster betrifft zurückgenommene Aufnahmeerklärungen nach § 22 Satz 2 AufenthG.
- Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sein Dokument mit häufig gestellten Fragen (FAQ) zur Handhabung von migrationsrechtlichen Verfahren vor dem Gerichtshof aktualisiert. In dem FAQ-Dokument versucht der Gerichtshof offenbar, seine Rolle als möglichst unbedeutend zu beschreiben. Hintergrund ist sicherlich die Debatte um die künftige Rolle des Gerichtshofs, die durch den kritischen Brief von neun europäischen Staats- und Regierungschefs im Mai 2025 losgetreten wurde.
- In einem umfangreichen und lesenswerten Online-Beitrag bespricht Eunseo Hong das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 5. Februar 2026 (Rs. C-718/24, Aleb), in der es um die Reichweite der (derzeitigen) europäischen Drittstaatenregelung ging.
- Im Verfassungsblog analysiert Georgios Athanasiou das Frontex-Urteil des Europäischen Gerichtshof vom 18. Dezember 2025 (Rs. C-136/24 P, Hamoudi gg. Frontex). Er weist auf ein weiteres am Europäischen Gericht anhängiges Verfahren hin (Rs. T-511/24, FM gg. Frontex) und zeigt zwei unterschiedliche Wege auf, wie das Gericht (das nicht mit dem Gerichtshof identisch ist) mit dem Urteil des Gerichtshofs umgehen könnte.
- Das Bundesverwaltungsgericht hat den Volltext seines Urteils vom 18. Dezember 2025 (Az. 1 C 27.24) zur „Fortentwicklung“ des Stufenmodells zur Identitätsklärung im Einbürgerungsverfahren veröffentlicht; der HRRF-Newsletter hatte bereits berichtet.
- Der italienische Staat wurde Medienberichten vom 19. Februar 2026 zufolge von einem Gericht auf Sizilien dazu verurteilt, 76.000 Euro Schadensersatz an die deutsche NGO Sea Watch zu zahlen, weil ein Seenotrettungsschiff der Organisation im Jahr 2019 rechtswidrig festgesetzt worden war. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni wird mit der Aussage zitiert, dass die Gerichtsentscheidung dem „Willen des Volkes“ zuwiderliefe und „objektiv betrachtet absurd“ sei.
GEAS-Reform
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026
Neu im Blog
Menschenrechtliche Anforderungen an die Altersfeststellung
18. Februar 2026
Menschenrechtswidrige Ablehnung von Prozesskostenhilfe
18. Februar 2026
Neueste Bücher
Dein Warenkorb (Artikel: 0)
Zwischensumme 0,00 €Versandgebühren und Steuern werden beim Bezahlen berechnet.Dein Warenkorb ist gerade leer!
Benachrichtigungen