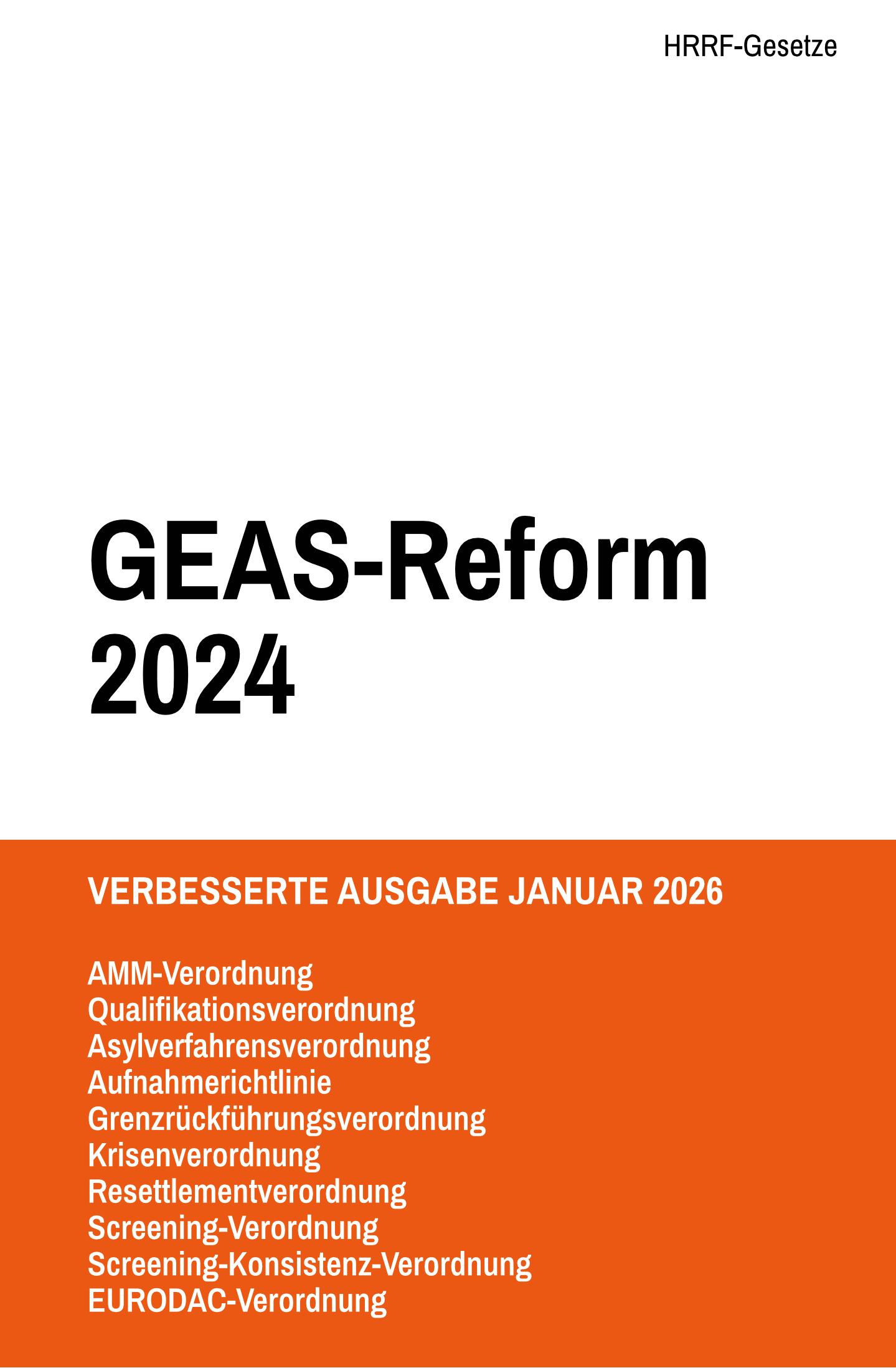Der Grundsatz der Nichtzurückweisung (Non-Refoulement-Gebot) hat durch ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine ganz neue praktische Bedeutung erhalten, nämlich bei Abschiebungen, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in einem Urteil festgestellt, dass die Zurückweisung eines Schutzsuchenden an der deutschen Grenze im September 2018 menschenrechtswidrig war. Außerdem beendet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge laufende Gerichtsverfahren und ist bereit, queeren Schutzsuchenden aus Georgien die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. Daneben geht es um eine schleswig-holsteinische Ausländerbehörde, die aufgrund von „Kapazitätsengpässen“ mehr als zwei Jahre lang nicht über einen Duldungsantrag entschieden hat, um einen Bonner Prediger, den die Ausländerbehörde aufgrund „bloßer Annahmen“ abschieben wollte, und um zwei baden-württembergische Amtsgerichte, die hartnäckig versucht haben, die Zuständigkeit für ein Haftverfahren dem jeweils anderen Gericht zuzuspielen.
Ausgabe
•
Kapazitätsengpässe
-
Zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse müssen vor Abschiebung erneut geprüft werden
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17. Oktober 2024 (Rs. C-156/23) verleiht dem in Art. 5 der EU-Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG niedergelegten Grundsatz der Nichtzurückweisung (Non-Refoulement-Gebot) eine ganz neue praktische Bedeutung bei der Durchführung von Abschiebungen. In dem Verfahren ging es um eine Familie, die in den Niederlanden einen Asylantrag gestellt hatte, der 2012 abgelehnt wurde, mit der Ablehnung der Asylanträge wurden Rückkehrentscheidungen (d.h. Abschiebungsandrohungen) erlassen. In der Folge stellten Familienmitglieder über einen Zeitraum von mehreren Jahren verschiedene Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln aus humanitären Gründen, die ebenfalls abgelehnt wurden. Nun stellte sich dem vorlegenden niederländischen Gericht die Frage, ob nach der Ablehnung der Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln die 2012 erlassenen Rückkehrentscheidungen immer noch eine Grundlage für die Durchführung von Abschiebungen bilden könnten, unter anderem deswegen, weil Familienmitglieder zwischenzeitlich neue zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse geltend gemacht hatten, jedoch ohne einen neuen Asylantrag zu stellen.
Der Gerichtshof hat zu dieser Frage festgestellt, dass Rückkehrentscheidungen von den nationalen Behörden nicht unreflektiert und quasi automatisch herangezogen werden können, um Abschiebungen durchzuführen, sondern dass die Behörden vor der Vollstreckung der Rückkehrentscheidung eine aktualisierte Bewertung der Gefahren im Zielstaat der Abschiebung vornehmen müssen, und zwar jedenfalls dann, wenn sie zwischenzeitlich einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt haben. Diese Bewertung, die von der zum Zeitpunkt des Erlasses der Rückkehrentscheidung durchgeführten Bewertung getrennt und unabhängig sein müsse, müsse es der nationalen Behörde ermöglichen, sich unter Berücksichtigung jeder eingetretenen Änderung der Umstände sowie jedes neuen, von einem Drittstaatsangehörigen gegebenenfalls vorgetragenen Gesichtspunkts zu vergewissern, dass es keine ernsthaften und durch Tatsachen bestätigten Gründe für die Annahme gebe, dass der betroffene Drittstaatsangehörige im Fall der Rückkehr in einen Drittstaat dort tatsächlich der Gefahr der Todesstrafe, der Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt werde. Denn nur eine solche aktualisierte Bewertung ermögliche es dieser Behörde, sich zu vergewissern, dass die Abschiebung den rechtlichen Voraussetzungen und insbesondere den in Art. 5 Rückführungsrichtlinie festgelegten Anforderungen entspreche. Außerdem verstoße eine nationale Regel oder Praxis, nach der die Prüfung der Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung nur im Rahmen eines Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes vorgenommen werden könne, gegen Art. 5 Rückführungsrichtlinie in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 GRCh. Von Betroffenen könne daher nicht verlangt werden, dass sie einen (neuen) Antrag auf internationalen Schutz stellten.
So logisch das Urteil des Gerichtshofs angesichts des klaren Wortlauts von Art. 5 Rückführungsrichtlinie ist, so viel Verwirrung wird es vermutlich in der deutschen Behörden- und Abschiebungspraxis stiften. In den meisten Fällen wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits in einem Asylverfahren gemäß § 24 Abs. 2 AsylG festgestellt haben, dass keine zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisse vorliegen, an diese Beurteilung sind die Ausländerbehörden gemäß § 42 AsylG gebunden. Sie werden vor Abschiebungen, die von diesem Urteil erfasst werden, nun stets mit dem Bundesamt Rücksprache halten müssen, damit es seine Entscheidung zu den zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen aktualisieren kann. Dabei wird es wohl um zwei Fallgruppen gehen, nämlich einerseits um Konstellationen, in denen die Ausländerbehörde zeitlich nach der Ablehnung eines Asylantrags einen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt hat, und andererseits um Konstellationen, in denen Betroffene gegenüber der Ausländerbehörde neue Umstände zu zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernissen geltend gemacht haben.
-
Zurückweisung an EU-Binnengrenze verletzt Menschenrechte
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinem Urteil vom 15. Oktober 2024 (Az. 13337/19) entschieden, dass die Zurückweisung eines im September 2018 an der deutsch-österreichischen Grenze von der Bundespolizei aufgegriffenen Schutzsuchenden nach Griechenland gegen Art. 3 EMRK verstoßen hat. Die Bundespolizei hatte ein Asylgesuch des Schutzsuchenden ignoriert und ihn ohne Dublin-Verfahren oder sonstige Prüfung in ein Flugzeug nach Athen gesetzt, wo er über mehrere Monate inhaftiert war, was der Gerichtshof ebenfalls als menschenrechtswidrig rügte.
Es habe keine ausreichende Grundlage für eine allgemeine Vermutung gegeben, dass der Beschwerdeführer nach seiner Abschiebung von Deutschland nach Griechenland Zugang zu einem angemessenen Asylverfahren in Griechenland haben würde, das ihn vor einer Zurückweisung schütze, und dass er dort nicht Gefahr laufen würde, einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung ausgesetzt zu werden. Weder die Verwaltungsvereinbarung, auf deren Grundlage der Kläger abgeschoben worden sei, noch eine individuelle Zusicherung hätten Garantien dafür vorgesehen, dass Asylsuchende, die auf der Grundlage dieser Vereinbarung abgeschoben würden, nach ihrer Abschiebung Zugang zu einem wirksamen Asylverfahren in Griechenland hätten, in dem die Begründetheit ihres Asylantrags geprüft würde, und dass Asylsuchende, die auf der Grundlage dieser Vereinbarung abgeschoben würden, in Griechenland nicht einer Behandlung ausgesetzt würden, die gegen Art. 3 EMRK verstoße, z. B. wegen der Haftbedingungen oder der Lebensbedingungen für Asylsuchende. Außerdem sei der Beschwerdeführer übereilt abgeschoben („hastily removed“) worden, ohne dass er vor seiner Abschiebung Zugang zu einem Anwalt gehabt hätte.
Es ist nicht so, dass diese Entscheidung inhaltlich überrascht. Dass Zurückweisungen von Schutzsuchenden an EU-Binnengrenzen, etwa im Rahmen des vom Gerichtshof angesprochenen „Seehofer-Deals“ von 2018, rechtswidrig sind, wusste man schon vorher (siehe etwa hier und hier und hier und auch hier). Dass Zurückweisungen innerhalb der EU auch menschenrechtswidrig sein können, ist spätestens seit dem M.S.S.-Urteil des Gerichtshofs vom 21. Januar 2011 bekannt. Das neuerliche Urteil des Gerichtshofs kommt zur rechten Zeit, um der Debatte um die Zurückweisung von Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen einen Riegel vorzuschieben.
-
Flüchtlingseigenschaft für queere Menschen aus Georgien
Bereits Ende 2023 war im Vorfeld der Einstufung von Georgien als sicherer Herkunftsstaat bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag ausführlich darauf hingewiesen worden, dass sich queere Menschen in Georgien in einer Lage befinden, die sie der Gefahr asylrelevanter Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure aussetzt, ohne dass die georgischen Behörden willens oder in der Lage wären, effektiven Schutz vor Verfolgung zu bieten. Ganz unabhängig davon, dass Georgien jedenfalls seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober 2024 (Rs. C-406/22) (siehe HRRF-Newsletter Nr. 166) kein sicherer Herkunftsstaat mehr sein kann, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Anfang September 2024 in zwei vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg anhängigen Berufungsverfahren (Az. 12 B 2/22 und 12 B 6/22) Prozesserklärungen abgegeben, die zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft für die betroffenen queeren Schutzsuchenden aus Georgien führen.
In dem einen Verfahren (Az. 12 B 6/22) hatte das Verwaltungsgericht Berlin das Bundesamt mit Urteil vom 30. September 2021 (Az. 38 K 547.19 A) verpflichtet, die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung hat das Bundesamt nun zurückgenommen. In dem anderen Verfahren (Az. 12 B 2/22) hatte das Verwaltungsgericht Potsdam die gegen die Ablehnung des Asylantrags eingelegte Klage mit Urteil vom 16. Juni 2021 (Az. VG 2 K 2725/20.A) abgewiesen und hat das Bundesamt nun seine Bereitschaft erklärt, die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen. Der LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt weist in einer Pressemitteilung vom 10. Oktober 2024 auf diese Entwicklung hin und fordert, die Einstufung von Georgien als sicheren Herkunftsstaat zurückzunehmen.
-
Pflicht zur Duldungserteilung bei faktischer Aussetzung der Abschiebung
Das Verwaltungsgericht Schleswig weist in seinem Beschluss vom 24. September 2024 (Az. 11 B 69/24) darauf hin, dass einem Ausländer, der ausreisepflichtig ist, dessen Abschiebung aber nicht betrieben wird, zwingend eine Duldung zu erteilen ist, weil das Aufenthaltsgesetz eine stillschweigende faktische Aussetzung der Abschiebung anstelle der förmlichen Duldung nicht vorsieht. In dem Verfahren waren dem Betroffenen von März 2022 bis heute lediglich Grenzübertrittsbescheinigungen ausgehändigt worden, über einen im März 2022 gestellten Duldungsantrag hatte die Behörde „offensichtlich aufgrund von Kapazitätsengpässen“ bis Herbst 2024 nicht entschieden.
-
Gerichte untersagen Abschiebung eines Bonner Predigers in den Kosovo
Die Stadt Bonn ist mit ihrem Versuch, einen der salafistischen Szene zugerechneten Prediger in den Kosovo abzuschieben, in zwei Eilverfahren sowohl vor dem Verwaltungsgericht Köln (Beschluss vom 2. Oktober 2024, Az. 5 L 1832/24 sowie Pressemitteilung vom selben Tag) als auch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster (siehe die Pressemitteilung des Gerichts vom 11. Oktober 2024) gescheitert. Die Stadt Bonn habe keine Gefahren benannt, die von dem betroffenen Prediger konkret ausgingen und wegen derer er die Ausweisung und Abschiebung in den Kosovo zunächst hinzunehmen hätte. Vielmehr beruhe das vorgelegte Material zu erheblichen Teilen auf bloßen Annahmen.
-
Negativer Kompetenzkonflikt unter baden-württembergischen Haftgerichten
Mit Beschluss vom 12. September 2024 (Az. 19 UH 2/24) musste das Oberlandesgericht Karlsruhe einen negativen Kompetenzkonflikt der Amtsgerichte Offenburg und Karlsruhe auflösen, die sich in einem Haftverfahren beide für unzuständig hielten. Das zunächst zuständige Amtsgericht Offenburg hatte das Verfahren gemäß § 106 Absatz 2 AufenthG an das Amtsgericht Karlsruhe abgegeben, das die Übernahme des Verfahrens ablehnte. Nach einem neuerlichen Abgabebeschluss des Amtsgerichts Offenburg wurde schließlich gemäß §§ 5 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2, 415 FamFG das Oberlandesgericht ins Spiel gebracht. Inhaltlich ging es darum, ob § 106 Abs. 2 S. 2 AufenthG auch dann anwendbar ist, wenn noch keine erstinstanzlich abschließend angeordnete Freiheitsentziehung vorliegt, sondern lediglich eine einstweilige Anordnung erlassen worden ist. Das könne man so oder so sehen, meinte das Oberlandesgericht, jedenfalls aber habe das abgebende Amtsgericht Offenburg die ihm eingeräumte Verweisungskompetenz nicht offensichtlich überschritten.
-
ELENA-Rechtsprechungsübersicht veröffentlicht
Die deutsche Koordination des European Legal Network on Asylum (ELENA) hat am 10. Oktober 2024 auf 24 Seiten eine Übersicht von europäischen und internationalen Gerichtsentscheidungen zum Migrationsrecht aus dem Jahr 2024 veröffentlicht. Die Übersicht ist thematisch gegliedert und zählt vor allem Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf.
Die Kommentarfunktion findet sich bei den einzelnen Beiträgen: Einfach auf die Überschrift klicken, um zum jeweiligen Beitrag zu gelangen.
Neu im Blog
GEAS-Reform 2024
Zuletzt aktualisiert am 29. Januar 2026
Indiz- und Bindungswirkung vorläufiger Maßnahmen des UN-Sozialauschusses?
20. Januar 2026
Im Oktober 2025 hat der UN-Sozialausschuss in einer Eilentscheidung entschieden, dass Deutschland einer vom Leistungsausschluss in Dublin-Fällen betroffenen Person existenzsichernde Leistungen gewähren muss. Dieser Beitrag analysiert die Entscheidung und beantwortet die Frage, ob ihr eine Indiz- und Bindungswirkung zukommt …
Dublin und die Drittstaaten
1. Januar 2026